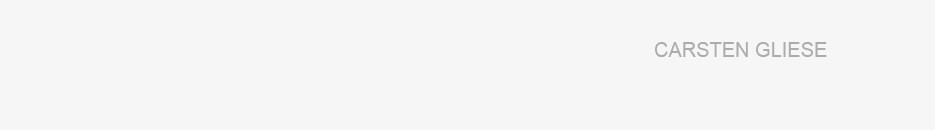1. "Von der Fläche in den Raum - Fotografien und Installationen von Carsten Gliese", Begleittext von Markus Heinzelmann im Katalog "Bildgestützte Räume", 1998
2. "Carsten Gliese: 1:1", Begleittext von Susanne Schulte im Katalog "1:1", 1999
3. "Gespiegelte Raumfragmente", Eröffnungsrede von Manfred Schneckenburger im Heidelberger Kunstverein, 2000
4. "Standortwechsel", Begleittext von Milo Köpp im Katalog "Parallele Architektur", 2002
5. "Ins Verhältnis-Setzen: Domestizieren", Eröffnungsrede von Volker Pantenburg im Kunstverein Ahlen, 2004
6. "Raumreflexionen", Begleittext von René Hirner im Katalog "Modell Ostahus", 2006
7. "Carsten Glieses ‘Modell Osthaus’ - über Wahrnehmungsräume und Raumwahrnehmung", Begleittext von Birgit Schulte im Katalog "Modell Osthaus", 2006
8. "Raumrekurs", Begleittext von Christoph Zitzlaff im Katalog "Eine Höhle für Platon", 2009
9. "Das Auge der Kamera", Begleittext von Renate Puvogel im Katalog "Carsten Gliese Arbeitslicht", 2009
Übersicht Katalogtexte 1998-2009
Von der Fläche in den Raum - Fotografien und Installationen von Carsten Gliese
Begleittext für den Katalog "Bildgestützte Räume" von Markus Heinzelmann, 1998
"Die eigenen vier Wände" lautet der Titel einer Installation, die Carsten Gliese im Jahr 1995 im Kunsthaus Essen realisiert hat. Es ist ein Name, der Assoziationen weckt an Gewohntes, geradezu Heimeliges, an einen Ort auf jeden Fall, an dem man jeden Quadratmeter zu kennen glaubt. Aber der Raum der "eigenen vier Wände" war ein leerer Raum, bevor ihn Carsten Gliese betrat, und bedeutete lediglich als Ausstellungsraum ein potentielles Zuhause für den Künstler, der dort seine Ideen umsetzen und präsentieren konnte . Carsten Gliese hat im Kunstraum Essen von verschiedenen Standpunkten aus Fotografien angefertigt. Ausgehend von der 'Flachware' des fotografischen Abzugs hat er die perspektivischen Fluchtpunkte errechnet, die das Auge der Kamera mit den anvisierten Objekten im Raum unsichtbar verbindet. Diese Fluchten hat er als hölzerne, weißbemalte Architektur in die Ausstellungshalle gebaut, so daß nunmehr kompakte Wände den natürlichen Vorgang des Sehens oder besser: den medialen Akt der Lichtbildnerei repräsentieren. Die Selbstreferentialität dieses Konzeptes erinnert an Strategien der Minimal Art, die bereits zum "look" geronnen war, als Carsten Gliese geboren wurde. Die Künstler seiner Generation interessieren sich heute in hohem Maße für die Avantgarde der späten Fünfziger und frühen Sechziger Jahre, ohne jedoch die für die Spätphase des Stils typische "offenheraus feindselige [Haltung] gegenüber einem Publikum" einzunehmen, das, wie Peter Schjeldahl es beschrieben hat, "bereit schien, jedes Ausmaß an Rätselhaftigkeit, Langeweile und sogar Brutalität zu dulden." 1 Andrea Zittel, Tobias Rehberger, Joep van Lieshout, Thomas Demand, Carsten Gliese - alle etwa im gleichen Jahr geboren - bedienen sich minimaler konzeptueller Strategien und spielen dabei mit dem Thema der "eigenen vier Wände". Zittel variiert den Gedanken des Reihenhauses, indem sie serielle Wohneinheiten baut, und löst das urbane Konzept der Siedlung (und der klaren Form) auf diese Weise in ortsungebundene Splitter auf. Van Lieshout entwickelt das modulare Prinzip der Minimal Art in seinen mobilhomes weiter, eine Art Baukastensystem, das auf einer bereiften Grundeinheit basiert, an die je nach Wunsch Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsräume angestückt werden können. Rehberger beschäftigt sich am stärksten mit dem "look", wenn er die Wohnphantasien seiner engsten Freunde im Design der Siebziger Jahre entwirft. Der Fotograf Demand, der Carsten Gliese nicht nur aufgrund der Verbindung von Fotografie und Skulptur vielleicht am nächsten steht, baut Interieurs aus Papier, die auf den großformatigen Abzügen wie ein ästhetischer overkill des Minimalismus wirken. Allen gemeinsam ist darüber hinaus die Betonung der Körperlichkeit, die einerseits als wärmend und schützend empfunden wird und zugleich mit einiger Distanz - sei es heiter, analytisch oder zynisch - als Bruchstück im globalen Raum wahrgenommen wird. II. Die Installation "Bildschleuse", die Carsten Gliese 1998 in der Tübinger peripherie realisiert hat, steht für diesen ambivalenten Umgang mit den Kategorien Geborgenheit und Zersplitterung. Der Künstler Milo Köpp hat in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung den Begriff des 'autoritären architektonischen Eingriffs' geprägt. Er bezieht sich damit auf die architektonische Reduzierung des Ausstellungsraumes auf zwei schmale hohe Gänge, die den Betrachter einengen und ihn geradezu zwingen, einen vorgeschriebenen Weg zu gehen. Auf diesem Weg passiert er einen Punkt, an dem sich zwei in die Holzwände eingelassene Videomonitore gegenüberliegen. Auf den Schirmen setzt sich unter Begleitung eines metronomisch tönenden Taktes ein Bild aus einzelnen Motiven des Ausstellungsraumes zusammen, zumeist drei oder vier isolierte Elemente, die wie Dominosteine aneinandergehängt werden. Hat die Motivkette eine gewisse Gestalt gewonnen, wird sie aus dem Bildraum hinausgeschoben, so daß lediglich ein Detail als Anknüpfungspunkt für das anschließende Bild stehenbleibt. Auch dies ist ein autoritärer Eingriff, denn Gliese verstellt nicht nur die gewohnte Sicht auf den Ausstellungsraum, er entscheidet darüber hinaus, welche Fragmente dem Betrachter an die Hand gegeben werden, um sich ein Bild von seinem Umraum zu rekonstruieren. Die Autorität des Künstlers, die auf der ungeschriebenen Vereinbarung beruht, daß er die Fäden der Erzählung in der Hand behält, wird hier auf drastische Art bloßgelegt. Wie gestaltet sich aber die Art des Erzählens bei Carsten Gliese? Der Besucher wird empfangen und geleitet - oder geschleust, wie es der Titel als Kommentar zur Zwiespältigkeit des Geborgenseins ausdrückt - und daraufhin den Splittern einer Wirklichkeit ausgeliefert, deren unmittelbare Erkenntnis ihm verschlossen bleibt. Der Künstler-Autor Gliese ist also im traditionellen Sinne allwissend: Nur er kennt die ganze Geschichte, die sich hinter den sequentiell addierten Fragmenten verbirgt, die die Videomonitore preisgeben. Dabei nutzt er seine Position jedoch nicht, um uns mit Bildern, Geschichten, Erzählsträngen zu beliefern, die außerhalb dieses begrenzten selbstreferentiellen Systems liegen. Kein Gott aus der Maschine also, keine Lovestories. III. Dem schroffen Zurückweisen des freien Erzählens im Sinne von Erfinden, Phantasieren, Fabulieren steht in der Kunst von Carsten Gliese überraschenderweise ein alchimistisches Moment gegenüber, wenn auch ohne esoterische Begleitmusik. "Ich fotografiere, um den Raum zu verändern", kommentierte der Künstler im Jahr 1994 seine Methode, mit Hilfe von fotografischem Material Sehpyramiden zu konstruieren und diese dann als architektonische Eingriffe im Raum zu realisieren. Das Moment des Verwandelns verbindet die Rekonstruktion (des fotografischen Blickes) mit der Konstruktion (einer künstlichen Welt). Als Angelpunkt dient der Vorgang des Fotografierens, der optische und chemische Momente auf sich vereint, die einen logisch und nachvollziehbar, die anderen verborgen und geradezu magisch.William Henry Fox Talbots (1800-1877) Kommentar aus der Pionierzeit der Fotografie macht diese Sonderstellung der Fotografie deutlich: "Das Vergänglichste aller Dinge, ein Schatten, das sprichwörtliche Sinnbild für alles, was flüchtig und vergänglich ist, kann durch den Zauber unserer natürlichen Magie und für immer festgehalten werden ... Werden bei irgend einem Vorgang vorerst vielleicht nur durch Zufall und in geringem Maße ungewöhnliche Erscheinungen erkennbar, so wird man diesen durch aufmerksame Beobachtung mit planmäßigen Versuchen unter Änderung der Bedingungen nachspüren, bis sich das Naturgesetz, das sich in ihnen offenbart, zu erkennen gibt und uns zu gänzlich unerwarteten Folgerungen führt, weitab von der alltäglichen Erfahrung und im Gegensatz zu dem, was man bisher glaubte." 2 Gliese nutzt die von Talbot beschworene natürliche Magie der Fotografie, allerdings nicht mehr als Instrument der wissenschaftlichen Erkenntnis der Welt, sondern um mit ihrer Hilfe die magischen Qualitäten unserer Welterkenntnis wiederzuentdecken. Die 'ungewöhnlichen Erscheinungen', von denen Talbot spricht, offenbaren sich zum Beispiel in der Serie von Raumaufnahmen, die Gliese mit Hilfe einer hohen Zahl von Mehrfachbelichtungen erstellt hat. 80 bis 100 Belichtungen bei jeweils unterschiedlicher Disposition der Lichtquelle waren nötig, um besondere Schattenwürfe im Raum geradezu skulptural herauszuarbeiten. Wie bei Talbot ist es der Schatten, das "Sinnbild für alles was flüchtig und vergänglich ist", dem mit Hilfe der Fotografie eine Materialität verliehen wird, die es in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis gar nicht besitzt. Zugleich hat Gliese einzelne architektonische Elemente 'weggeblitzt', das heißt die Materialität der Wände, Mauern und Böden unter der Flut des Blitzlichtes zum Verschwinden gebracht. Dieser Prozeß bleibt auf dem fotografischen Abzug sichtbar und läßt sich in Teilen als Vorgang für den Betrachter rekonstruieren, weil sich der Raum aus seinen Fragmenten zumindest in seinen konstruktiven Grundzügen erahnen läßt - und weil Unschärfen, Lichtkegel und bisweilen sogar zufällig im Bild sichtbare Kabel und Schatten von der Gegenwart des Fotografen zeugen. Daß das fotografische Material von dieser Zersplitterung des Aufnahmevorgangs in unzählige Teile überfordert ist, zeigen die empfindlich verschobenen Farbskalen der Abzüge, die Gliese weder bei der Vergrößerung noch im Fotoshop manipuliert. IV. Der flüchtige Ort, an dem sich die Gegenstände mit ihren Schatten verbinden, die Ideen mit der Wirklichkeit, jenes Zwischenreich, in dem sich Sehen und Erkennen, Konstruktion und Rekonstruktion begegnen, dort findet sich das bestimmende Thema der Kunst von Carsten Gliese. "Die eigenen vier Wände" des Künstlers eben. 1. Peter Schjeldahl: Minimalisms, in: Art of Our Time: The Saatchi Collection, Vol. 1, New York 1984, S. 11-24; hier zitiert nach der deutschen Übersetzung: Peter Schjeldahl: Minimalismus, in: Gregor Stemmrich (Hg.): Minimal Art. Eine kritische Retrospektive, Dresden und Basel 1995, S. 556-588, Zitat S. 565. 2. Zitiert nach Wolfgang Baier: Geschichte der Fotografie: Quellendarstellungen zur Geschichte der Fotografie, München 1980, S. 83f.
Carsten Gliese:1:1
Begleittext aus dem Katalog "1:1" von Susanne Schulte, 1999
Die Welt in unserem Kopf IST nicht, sie WIRD erst durch uns. Wir schaffen die Welt in den Kopf. Aber wer sind wir? Wir sind Träger eines Organs zur Schaffung von Weltbildern, das auch Hirn genannt wird.
Ernst Peter Fischer: Die Welt im Kopf
Drei „Modell“-Arbeiten Carsten Glieses - „Modell Hagen“, „Modell Bochum“, „Modell Hawerkamp“ - dokumentiert der Katalog „l: 1 “. Unter diese Überschrift stellt der Künstler Installationen, Modelle in ihrem jeweiligen architektonischen Pendant, die Modellbildung und Modellhaftigkeit in der Kunst wie im Leben thematisieren und die darüber hinaus lesbar sind als Modelle von Wahrnehmung als Modellbildung, von Erkenntnis nicht als Abbildung sondern als Konstruktion.
„1:1“Das Modellverhältnis erscheint zunächst im Katalogtitel „1:1“ ganz konventionell als eine zweistellige Relation zwischen empirischen Objekten, dem baulichen Original und seinem künstlerischen Modell. Dieses ist in den Installationen Carsten Glieses dem „echten“ Gegenstand, seinem Bezugsraum - der Hawerkamphalle in Münster, dem Foyer der Industrie- und Handelskammer in Hagen oder dem Treppenhaus im Museum Bochum - nachgebaut. Die Präsentation der Modell- als einer 1:1 -Beziehung scheint mit der formalen Beschreibung ihre Objektivität zu implizieren, als handle es sich dabei um ein exaktes Urbild-Abbild-Verhältnis bzw. eine um subjektunabhängige strukturelle, lsomorphie- oder Analogierelation zwischen (primärem) Original und (sekundärem, zwei- oder dreidimensionalem) Modell. Für diese spräche auch das Medium Fotografie, aus dem die Arbeiten entwickelt sind, mit seinem Nymbus der Authentizität, der irgendwie 1:1-Wiedergabe eines Objektes.
Doch die Annahme einer solchen Objektivität wäre naiv, was nicht nur die Reflexion des Modellbegriffes an sich, sondern schon ein genauerer Blick auf Katalog- und Einzeltitel merken läßt, repräsentiert doch der Doppelpunkt im „1:1“ ein Verhältnis, in welches ein Subjekt zwei materielle Gegenstände setzt, also einen geistigen Akt als den Ursprung der Relation. Das Modellsystem wird mithin als dreistellig erkennbar, seine Positionen sind: Original - Subjekt - Modell. Ein Modell ist ein subjektives Konstrukt, das ein Ich für bestimmte Zwecke, nach seinen Interessen herstellt. Dieses Verhältnis ist auch anhand der Einzeltitel Carsten Glieses zu reflektieren. Gerade indem sie die Präposition oder Deklination aussparen, die die Beziehung des Begriffs „Modell“ zum Namen des jeweiligen Ortes regelt, weisen sie auf das Titel gebende bzw. lesende Subjekt zurück, auf seine Möglichkeiten, die beiden Wörter in Beziehung zu bringen, auf die Notwendigkeit, in dieser Hinsicht z.B. das „Modell Hagen“ zu befragen, sowie auf die Reflexion dieses Fragens und Konstruierens selbst: Handelt es sich um ein Modell etwa im Foyer der SIHK Hagen, um ein Modell dieses Foyers, um eins des Foyers im Foyer selbst oder ist gar die gesamte Arbeit ein Modell für etwas andres, von etwas andrem, das unausgesprochen bleibt? Und wenn so breit gefragt werden kann, ist dann eine „1:1“-Relation so unproblematisch und voraussetzungslos eindeutig, wie es die mathematische Schreibweise nahelegt? Am Beispiel - Modell? - des“Modells Hagen“ möchte ich diesen Fragen nachgehen.
1In der Decke des Foyers der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in Hagen befindet sich mittig, etwa ein Drittel der Raumbreite in Längsrichtung überspannend, ein Giebeldach, das architektonisch hervorstechendste Element des Raumes. Es mißt 28 m x 2 m und ist verglast, dem Raum gibt es Höhe und Tageslicht. Seitlich begrenzt ein Sims das Fenster, in größerem Abstand queren es weiße Betonträger. Die weißen Fenstersprossen und der gleichfarbige First strukturieren die Glasfläche. Wie ein Passepartout flankieren das Fensterdach eine Lichtrohr- und eine Strahlerleiste. Der Steinfußboden des Foyers ist hell, die weißen Wände sind fensterlos. Türen aus Holz oder Glas führen zu den anliegenden Seminar- und Konferenzräumen, Fluren, Innen- und Außentreppen. Die üblichen Utensilien einer Durchgangs- und Wandelhalle statten diesen Zweckraum aus: Stühle, Tische, Aschenbecher, Heizkörper, Lampen, Hinweisschilder, Notfallgeräte, Grünpflanzen, Abgestelltes, Geparktes.
:1In Hagen hat Carsten Gliese ein so genanntes „Modell“ in das Lichtdach des Foyers gehängt, welches er, wie ein Maler die Leinwand, als Bild- bzw. Modellträger benutzt. Dieser changiert je nach Wetter und Tageszeit zwischen weiß, grau, blau, mal ist er gelb und rot oder schwarz; immer trägt er die Farbe des Himmels. Seiner alltäglich-pragmatischen Funktion ist das Lichtdach somit enthoben, als farbiger Modellträger ist es in einen ästhetischen Kontext überführt.
Im Lichtdach nahm ich zunächst einen langgestreckt flachen, den funktionalen Geraden, Flächen und Winkeln des Umraums konträren, kantigen und verwinkelten, teils flächigen, teils linienförmigen, zierlichen Schwarz-Weiß-Grau-Körper mit leicht bräunlichen Rändern wahr. Das Objekt war nicht auf den ersten Blick identifizier- und benennbar, obwohl es den Begriff „Modell“ im Titel führte. Es hatte mein ästhetisches Interesse erregt, es gefiel mir durch seine Form. Ich untersuchte die Technik. Mit Saugnäpfen und Fäden hing es an den Glasscheiben. Fotografische Bilder waren auf Honeyboard aufgezogen und einzelne Formen ausgeschnitten. Die Kartonkante wurde nicht kaschiert, so daß das Gerüst der aufgeschnittenen und angerissenen Pappwaben sichtbar blieb - Spuren des Herstellungsprozesses, Betonung der Kante und des Gemachtseins, ein Moment von Imperfektion. Bei näherem Hinschauen, die Strecke abwandernd, den Kopf dabei tief in den Nacken gebeugt, geleitet von der theoretischen Vorgabe des Titels „Modell Hagen“, konnte ich dieser Struktur, zunächst nur partiell, Gegenständlichkeit und Bildhaftigkeit, Bedeutung, zuschreiben. Ich erkannte fotografisch reproduzierte Elemente des Raumes, in dem ich mich bewegte, wieder, eine Stuhlgruppe, einen Ascher, das Gerippe des Lichtdachs selbst in dem blauen Modellträger mit weißen Leisten über mir. Diese Teile waren mit andern, die ich (noch) nicht benennen konnte, wie eine Kette aneinandergereiht zum „Modell“. Die unbekannten Objekte, so schloß ich aus dem Titel, wären auch aus Fotografien des Foyers gemacht. Diese Annahme leitete mein Tun. Hin- und hergehend, mich drehend, denn Oben und Unten waren nicht zu bestimmen, suchte ich den Ort nach Formen, die ich im „Modell“ sah, ab. Meinen punktuellen Eindruck konnte ich ergänzen und andere Raumgegenstände in den bizarren Formen unterm Himmelsgrund identifizieren: Heizkörper mit anschließendem Fensterrahmen in Form des großen Druckbuchstabens „E“, daran ein Deckenträger, an diesem Lampenröhren etc., alle aus Fotos mit ihrem Ursprungskontext ausgeschnitten und bis auf eine winzige Schnittstelle auch voneinander isoliert - freigestellte, fragile, selbständige Formen, schwarz-weiß in blauen Grund gesetzt. Das ästhetische, das absolute Formmoment schien die Abbildungstunktion des Fotografierten jedoch in den Hintergrund zu weisen. Dennoch interessierte ich mich weiter für das Modellhafte am so genannten „Modell“. Am Ende erkannte ich die Hängekonstruktion als ein Gebilde, welches alle Elemente des Foyers aufweist in der Reihenfolge, wie sie in diesem vorkommen und auch in dessen Logik von Lampe-an-Decke-an-Wand oder Stuhl-auf-Fußboden etwa, doch mehrmals um 180 Grad - quasi jeweils mit dem abgebildeten Lichtdachgerippe als Achse - gekippt. Die Mitte des Modells ist der Ort, bemerkte ich schließlich, wo sich die beiden Enden des repräsentierten Rundblicks treffen; nicht von links nach rechts, am einen Ende des Lichtdachs beginnend, am anderen endend, komplett linear stellt es ihn dar. Meine Betrachtung, mein entdeckendes Kreisen, schloß diese Kreisbemerkung ab.
Der Produktionsprozeß vollzog sich folgendermaßen. Carsten Gliese hat das Foyer der Südwestfälischen IHK zunächst ganz pragmatisch abgeknipst. „Es ging mir“, wie er sagt, „nicht um gute Fotografie, sondern einzig um eine fotografische Bestandsaufnahme des Raumes nach dem Kriterium, daß das Vorhandene vollständig abgebildet ist“. Hier wird Material gesammelt, der Raum in zweidimensionale Schwarz-Weiß-Bilder übersetzt und zerlegt. Dabei nimmt der Fotograf seinen Gestaltungswillen maximal zurück. Im zweiten Schritt sichtet er Dutzende von Abzügen und sortiert die „Glücksschüsse“ (Gliese) aus, solche Bilder mit Formen, die ihn persönlich interessieren und die zugleich den Raum repräsentieren. Er scannt sie ein, stellt die „schönen“ (Gliese) Formen - das Formmoment akzentuiert die auf’s Schwarz-Weiß reduzierte Farbigkeit - digital frei und druckt sie in der benötigten Größe aus.
Analyse und Zerlegung folgt die Synthese. Die Foto-Ausschnitte sind, neben dem attraktiven Lichtdach, das Material der künstlerischen Gestaltung Carsten Glieses im engern Sinn. Er kombiniert, ich fasse zusammen, die auf Honeyboard aufgezogenen und ausgeschnittenen Formelemente entsprechend der realen Abfolge der korrespondierenden Elemente im Raum, wobei sich Anfang und Ende des Rundblickbildes in der Mitte des Modells treffen, nach Maßgabe des Formates, welches das Dachfenster vorgibt, und nach seinem inneren Form- und Schönheitsempfinden. Eine ästhetische Konstruktion ist über einen komplexen, subjektiven, intuitiv wie konzeptuell geleiteten Transformationsprozeß in der Lichtachse eines kunstlosen Zweckraums entstanden, welcher der Künstler den Titel „Modell Hagen“ gibt.
In der Reflexion sind der Rezeptions- wie der Produktionsprozeß beim „Modell Hagen“ als komplexe, ideell geleitete subjektive Konstruktionshandlungen erkennbar, die zwischen dem Abbild im „Modell“ und seinem Referenten im Raum kreisen, und zwischen dieser Zuschreibung und der Wahrnehmung reiner und schöner, autonomer Form die Schwebe halten. In der produktiven und rezeptiven Auseinandersetzung mit dem „Modell Hagen“ wird sein Original, das SIHK-Foyer, vom Gegenstand praktischer Nutzung in ein Objekt der ästhetischen Betrachtung und Gestaltung überführt. Nicht mit einem pragmatischen Zwecken dienenden NormalModell haben wir es zu tun, sondern mit einer aus Anlaß und mit den Gegebenheiten des Raumes als ihrem Material realisierten ästhetischen Modell-Idee.
1:1Carsten Glieses „Modell“ in der südwestfälischen Industrie- und Handelskammer konterkariert den Begriff des Modells, der dem repräsentierten, ökonomisch orientierten Lebensbereich, den Alltagskonventionen eignet. Modelle sind Mittel zu ihnen äußeren Zwecken. Aufgrund einer Struktur-, Verhaltens- oder Funktionsanalogie zum Original liefern sie Erkenntnisse über es, die mittels direkter Operationen zu gewinnen unmöglich oder zu aufwendig wäre. Carsten Glieses „Modell“ jedoch indiziert nicht und es demonstriert nichts, was ohne es in der Realität bei einiger Aufmerksamkeit nicht sichtbar wäre, auch wenn es mit Fotoausschnitten von Wirklichem und mit Gestaltanalogien arbeitet, welche die Bezeichnung „1:1“ rechtfertigen könnten. Die Funktion der Ableitung von Steuerungsprozessen oder der Projektierung gar scheint ein solches Pappmodell vollkommen ad absurdum zu führen. Es kann nur angeschaut werden, sonst kann man, im Sinn der Lebenspraxis, nichts mit ihm tun. Mehr noch, der Künstier stellt mit dem „Modell Hagen“ in gewisser Weise sogar die Zweck-Mittel-Relation von Original und Modell auf den Kopf. Auch demgemäß hat er die Ansicht über Kopf mehrfach um 180 Grad gekippt und das Modell gewiß nicht ohne metonymische Hintergedanken gerade über dem Kopf des Betrachters installiert, dem es selbigen verdreht, wenn es ihn in eine Art Hans-guck-in-die-Luft verwandelt (vielleicht), der in der ästhetischen Betrachtung punktuell seinen Arbeitskontext vergißt ... Denn das Original gebrauchte Carsten Gliese ‚nur’ als Mittel und Material für sein „Modell“, die Fotos vom Foyer lieferten ihm das Formenreservoir zur Gestaltung seines eigentlichen, des ästhetischen Zwecks. Das „Modell Hagen“ ist Zweck in sich selbst, nicht nachgeordnete Repräsentation des IHK-Kontextes und seiner Zwecke, sondern selbst Original, das diese relativiert und hinterfragbar macht. Es ist, was es ist - 1:1.
Zweckfreiheit ist das genaue Gegenteil von Sinnlosigkeit, initiiert doch das „Modell Hagen“ einen komplexen Rezeptionsprozeß, der mit der Arbeit immer auch sich selbst bedenkt. Gerade an der Grenze zur Abbildungsfunktion legt er die spezifische Qualität des Kunstwerks frei: seine Selbstreferentialität als die ästhetische Funktion par excellence, die sich aus seiner zwar regelgeleiteten, doch nicht zweckdienlichen Form ergibt. Das Kunstwerk ist nicht Zeichen für etwas anderes, Modell eines Originals, in dem es aufginge, sei dies ein Referent, sei’s eine ideelle Bedeutung. Begrifflich nicht aufhebbar verweist es zuerst und zuletzt auf sich selbst - in einer Art Kreisbewegung,
die in der Arbeit selbst, konsequenterweise, Bild wird in dem oben besprochenen Zusammenschluß beider Enden in der Mitte.
Indem das „Modell Hagen“ nicht von sich weg und auf ein der Betrachterin Äußeres zeigt, wirft es die Rezipientin aber auf sich selbst zurück, auf die Beobachtung dessen, was sie tut, wenn sie sich mit ihm befaßt. Zunächst implizit, in der Beschreibung und in der Nichtung aller pragmatischen Zwecke, dann explizit ist Wahrnehmung selbst thematisch, wofür der genannte Kreis ebenfalls metaphorisch steht. Das „Modell Hagen“ ist als das Hagener Modell für Wahrnehmung lesbar, worin ein Original, das Foyer, und dessen ästhetisches „Modell“ im Himmelsdach für den wahrzunehrnenden Gegenstand und sein Bewußtseinskorrelat stehn, worin die Rezeption des Kunstwerks aber, weil darin der alltägliche Wahrnehmungsautomatismus gestört ist, den Akt der - naiv formuliert - Transformation eines materiellen Objekts in eine Bewußtseinstatsache reflektierbar macht. Wahrnehmung, so läßt uns das „Modell Hagen“ erfahren, ist nicht so etwas wie wahllos Abfotografieren oder Knipsen, sondern eine, wenn auch zumeist unbewußt gesteuerte, aktive Handlung des Subjekts. Beim Sehen entstehen nicht Bilder als Abbilder des Gesehenen im Gehirn, sondern das Ich generiert seine Konstruktionen der Objekte. Wahrnehmung ist kreative Gestaltung und beschreibbar mit dem Modell des Modells. Die Weit ist unser Modell von ihr, geschaffen, das zeigen Carsten Glieses Modelle, durch hypothesen- und interessengeleitete Akte der Konstruktion: „1:1“.
Gespiegelte Raumfragmente
Eröffnungsrede von Manfred Schneckenburger im Heidelberger Kunstverein, 2000
In den letzten 30 Jahren hat sich die Skulptur nicht zuletzt aus Annäherungen an die Architektur, aus Kreuzungen regeneriert. Nicht als traditionelle „Bauplastik“, nicht einmal als avanciertere „Kunst am Bau“. Hier geriet vieles zur Mésalliance. Wohl aber, indem sie Grundformen des Architektonischen aufnahm und verwandelte. In den 70er Jahren: Brücken, Türme, Korridore, Labyrinthe. Gaston Bachelards „Poetik des Raumes“ zog in die Plastik ein. In den 80er Jahren: „Modelle“ zwischen Architektur, Möbel und Projektionsraum für Erinnerungen, Assoziation.
In den 90er Jahren – ich spitze das aus nahe liegendem Anlass etwas zu – in den 90er Jahren also: Carsten Gliese. Er bestimmt das Verhältnis von Architektur und Skulptur durchaus neu. Er gibt dem schwanken Begriff „Rauminstallation“ sicheren Stand und einen direkten Klang. Er bestückt Räume nicht phantasievoll oder genau, sondern benutzt und übersetzt sie. Er formuliert sie unter anderen Bedingungen neu. Sein Zugriff gilt unmittelbar der Architektur und geht doch, wörtlich, auf Distanz. Seine Haltung ist Annäherung und Entfernung zugleich. Sie bestätigt den Bau und zielt doch auf die autonome Skulptur. Ich wüsste, außer dem früh verstorbenen Gordon Matta-Clark, keinen Künstler, der beide Gattungen so dicht ineinander verhakt und doch jede so sehr zu sich selber bringt. Gliese erschließt das bildnerische Potential des gebauten Raumes und gewinnt es für die Skulptur. Denn was dabei herauskommt, ist eine eindrucksvolle skulpturale Konstellation – keine Verschnitt. In früheren Arbeiten setzte er das Bauwerk dem Kameraauge aus. Die perspektivische Verkürzung machte aus Geraden steil zugespitzte Fluchten, die Gliese mit allen Schrägen und Verkürzungen penibel nachkonstruierte. Schon ein simpler Türausschnitt brachte so ungemein dynamische Gefüge hervor.
In Heidelberg folgt er einem anderen Konzept. Als ich gestern die Halle im Kunstverein betrat, war ich zunächst befremdet. Das bekannte Muster, Perspektiven nachzubauen, verfing nicht mehr. Dann entdeckte ich nach und nach das neue Prinzip. Der Raum unter der Empore ist partiell, mit seinen Seitenwänden, nach außen geklappt. Der Künstler versuchte meiner Vorstellungskraft mit dem Hinweis auf Schnittmuster auf die Sprünge zu helfen. Weil ich davon jedoch überhaupt nichts verstehe, werde ich diese mentale Hilfsaktion erst gar nicht vorstellen. Ich werde mich ohnedies hüten, Ihnen die Umklappungen Schritt für Schritt vorzuexerzieren und Ihre Vorstellungskraft damit um einen aufregenden imaginativen Akt bringen. Nur so viel, um ein wenig anzuschieben:
Die Installation hat ihren formalen Ausgangspunkt in der potentiellen Verschalung der architektonischen Grenzen des Raumes unterhalb der Empore. Gliese verkleidet dabei die Wände, einen schmalen umlaufenden Abschnitt der Decke und Boden und an der offenen Front auch die Balustrade mit den beiden Pfosten mit einem sieben Zentimeter starken Mantel aus Holz. Während er die Rückwand tatsächlich verschalt, sind die anderen Elemente aus der imaginären Verschalung der Seitenwände und der Frontpartie kombiniert. Wie bei einem mobilen Stellwandsystem zerlegte der Künstler diese in Teilstücke und schiebt sie zu freistehenden Architekturskulpturen zusammen. Der Betrachter kann - in seiner Vorstellung - den ganzen Aufbau auffalten und, so wie an einem Scharnier, an den ursprünglichen Ort zurückschwenken. Er muss seine Vorstellung dabei, gewiss, verschränken und verrenken, denn zumindest die Pfeiler wären einer realen Rückführung im Weg. Doch darauf kommt es eben nicht an. Das Ganze funktioniert nur im Kopf. Die alte Idee Duchamps, dass der Betrachter das Kunstwerk erschafft – auf verblüffende Weise aktualisiert und neu interpretiert!
Ein Spiel nach bestimmten Regeln, die zu entdecken sind. Das Verfahren klingt vertrackt. Das Ergebnis irritiert, ist jedoch von hoher Logik, Präsenz und Genauigkeit. Einer Präsenz zwischen sinnlicher Anschauung und rationalem Konzept. Zwischen handfester Realität und fiktiver Rekonstruktion, zwischen Stellage und Vorstellung. Dabei ist der Ausgangsraum von simpelstem Zuschnitt. Ein ungegliederter, rechteckiger Raumeinzug. Gliese macht daraus, ohne von den Spielregeln abzuweichen, einen mehrteiligen, kontrastreichen, asymmetrisch rhythmisierten Aufbau. Er schlägt z.B. die beiden Pfeiler einer einzigen Seite zu und bricht damit das langweilige Regelmaß. Er faltet die rechte Wand in drei Teilstücke und erreicht damit eine differenziertere gestufte Struktur. Er entscheidet, im Rahmen der Regeln, rein künstlerisch. Er ist auf dem Weg von der Schalung zur Skulptur.
Aber nicht genug. Diese Skulptur gewinnt ihre vollkommen eigenen Akzente und Gewichte. Als Auftakt eine Art T-Träger; eine elementare Formel für Tragen und Lasten, Statik und Konstruktion. Dann steht Durchblick gegen Anblick, offene gegen geschlossene Form: Grundphänomene des Raums, auf ihren knappsten Nenner gebracht. Decken und Boden unter der Empore, eigentlich Begrenzungen bar jeder Ausdrucksqualität, werden zu wichtigen Rahmenelementen von hoher plastischer, fast theatralischer Wirksamkeit.
Vor allem aber: die neue Abfolge hat sich von der Vorlage getrennt. Sie entwickelt sich aus eigenem Recht. Nach dem Auftakt des T-Trägers der Gang um die erste Wand: was frontal wie ein massives Volumen erschien, kompliziert sich zum rechtwinklig gestuften Überhang. Dann die rechte Wand: drei Teile, verschiedene Stufen, Versprünge – für den kargen Carsten Gliese fast schon opulent. Als ich gestern, in dicken Anführungszeichen, das Wort „barock“ in den Mund nahm, zuckte er leicht zusammen, aber im Rahmen seiner puristischen Verfahren ist das bemerkenswert reich. Ein schlüssiger Ablauf vom Einfachen zum vielfach Gegliederten. Umkehr macht keinen Sinn.
Ich weiß, das war eher Schwarzbrot als Torte. Eher eine Herausforderung an Ihre Vorstellungskraft als ein Ruhekissen für Empathie. Nicht einmal Metaphern taugen zur Auflockerung für diese nüchterne Präzision und doch bleibt das Kalkül keineswegs abstrakt, sondern bewegt sich sinnlich und lebhaft hin und her.
Standortwechsel
Begleittext aus dem Katalog "Parallele Architektur von Milo Köpp, 2002
Bei einer Installation wie „Modell Heidelberg“ richtete sich Carsten Glieses Interesse noch darauf, in die Architektur des Raumes eine künstlerische Gestaltung zu implantieren, deren Ausrichtung und Plazierung aus den Gegebenheiten des Ausstellungsraumes abgeleitet ist. Ihre Konzeption basiert auf der Idee einer einheitlich geschlossenen Form der Bearbeitung eines eindeutig begrenzten Bereiches im Heidelberger Kunstverein. Die fragmentarische Anmutung der Installation findet ihren Grund eher in der sich scheinbar verselbständigenden Anordnung der Körper, die sie zu Architektur zitierenden Raumplastiken wandelt, als in der Vorstellung, im Bruchstück sei der Architektur etwas hinzugefügt, das als Zeichen einer möglichen Veränderung dem Betrachter Spielraum für ein gedankliches Fortsetzen liesse. Eine Annäherung an „Modell Heidelberg“ erfolgt im Nachvollziehen der zugrundeliegenden Konstruktionsregel. In ihrem Erkennen und Verstehen findet der Betrachter den Schlüssel zum Einstieg in eine Interpretation des Werkes.
Mit dem „Modell Hattingen“ (2001) erschliesst sich Carsten Gliese künstlerisches Neuland. Im Treppenhaus im 2. Obergeschoss des Stadtmuseums Hattingen hat er eine zweiteilige Arbeit aufgebaut, die aus einer im Computer bearbeiteten Fotomontage und einer Verkleidung der Wände mit Gipsreliefs besteht. Eine grossformatige Fotoleinwand bedeckt fast vollständig die Aussenwand des Flures. Sie zeigt die digitale Montage von vier monumental vergrösserten Farb-Fotografien eines Graupappemodells, das eine architektonische Besonderheit des Treppenhauses stilisiert darstellt. Wie ein grosses „Z“ zieht sich die Brüstung zwischen Flur und Treppenaufgang gleichermassen begrenzend wie verbindend durch die Etagen des Gebäudes. Der Künstler hat diesen Brüstungsverlaufes mit dem Fussboden des zweiten Obergeschosses als eingehängte Ebene bis hinunter in die 1. Etage als Körper freistehend nachgebaut. Im Bild sind drei unterschiedliche Modellzustände aus vier Perspektiven und mit unterschiedlicher Ausleuchtung einander zugeordnet.
Auch wenn es ungewöhnlich sein mag, ist es richtig, eine Bildbeschreibung von rechts nach links zu versuchen, denn das entspricht dem Erleben des Betrachters, der, wenn er die obere Etage erreicht hat, diese Bildseite zuerst sieht und dann über den Flur nach links daran entlang geht.
Die Perspektive des rechten Einzelmotivs ist fast frontal auf die Schmalseite des „Z“ gerichtet und lenkt den Blick nahe der Mittelachse des Flures in das Modell, rechts und hinten gefasst von einer Wand, die in Brüstungshöhe abgeschnitten ist. In der nächsten Einstellung präsentiert sich der Brüstungskörper nach links gedreht, und wird ohne seitliche Begrenzung ausschliesslich durch die Rückwand gestützt. Die beiden bilden mit den Plattformen der Bodenflächen eine umlaufende Galerie, die links zu den im Modell angesetzten Stufen führt. Hier ist das „Z“ aus der Perspektive des Treppenaufganges stark vergrössert nur im Anschnitt abgebildet. Doch besteht auch diese Darstellung aus der Verbindung zweier Perspektiven, passgenau aneinandergefügt in der Brüstung, aber augenfällig in dem Knick der nach vorn aus dem Bild laufenden Stufen, des Lichteinfalls und der Schärfenebene. Keiner der fotografierten Modellzustände ist eine wahrheitsgetreuere Umsetzung der vorhandenen Architektur. Sie sind nach dem Modellgedanken vollständig in Bezug auf das, was sie zeigen wollen.
Die Fotomontage kombiniert die Gebäudeskizzen zu einer weitgespannte Komposition, in der das in der Museumsarchitektur flankierende Element der Brüstung zum zeichenhaften Protagonisten wird. Die Verbindung verschiedener Perspektiven mit ihrer harten Ausleuchtung, die scharf gezeichneten Pappkanten, an denen sich der wiederholte Schnitt des Cutters mit der Intensität seines Druckes sichtbar eingeschrieben hat, die Wände und der Boden, die sich ohne echtes Volumen nur in der Materialstärke der Pappe zeigen, die vormals verleimten Kanten, deren eigentlich winzige Abrissflusen in grotesker Grösse auf einen kraftvoll ruinösen Zugriff deuten, das manipulierte Schattenspiel, in dem die Motive auf einem unbestimmten Grund zu einer Einheit verschmelzen - all das erzeugt den Eindruck eines surrealen Kulissenbaus in der Welt der Bilder, keinesfalls den eines umsetzbaren Baukörpers.
Neben der Präsentation des Bildes hat Carsten Gliese in die Architektur auch handwerklich eingegriffen. Die Fotoleinwand schliesst rechts bündig mit einer aufgespachtelten Gipsfläche, die, vollständig die Wand bedeckend, noch mit einem schmalen Streifen um die Ecke geführt ist. Ebenso ist die dem Bild zugewandte Partie der Brüstung mit der Oberfläche der schwarzen Granitabdeckung verkleidet und ihre Stirnseite komplett ummantelt. Darunter schliesst das Gipsrelief, gleichsam den Treppenaufgang rahmend, in der Breite der Brüstung auf der ersten Etage ab. Der Gips ist in feiner Spachteltechnik aufgebaut, die Flächen unversiegelt, also nicht nur wegen der bruchgefährdeten Kanten empfindlich gegen fahrlässige Berührung sondern auch gegen Verschmutzung. Mit der Präzision einer Zeichnung heben sich die im Weiss leicht changierenden Gipsflächen von dem Umraum ab. Doch gehorcht ihre Positionierung keiner formalen Logik, nach der sie sich aus der Architektur oder dem Foto erklären liesse. Eine äusserliche Übereinstimmung zwischen Bild und Flächenrelief findet sich nur vordergründig zwischen Pappkante und Gipsabschluss, zwischen Schauwand und Verkleidung. Beiden, der monumentalisierten Modellskizze mit ihren Veränderungen und der materiellen Beschaffenheit des Gipses haftet jedoch der temporäre Charakter des Zwischenzustandes und des Vergänglichen an.
Tatsächlich handelt es sich bei dem Bildmotiv um eines der typischen Arbeitsmodelle, mit denen Carsten Gliese seine Installationen plant und vorbereitet. Die Zustände spiegeln seine künstlerische Strategie, sich Architektur zu nähern. Er isoliert ein ihm auffälliges architektonisches Merkmal und untersucht dessen gestaltende und funktionale Bedeutung. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet er es in seinem architektonischen Umfeld, indem er Teile entfernt oder verändert. In dieser Beschäftigung kristallisiert sich seine Entscheidung für eine bestimmte Intervention in dem Ausstellungsraum heraus. Als raumfüllendes Bildmotiv verliert das Modell hier aber seine Gültigkeit als Hilfsmittel. Die künstlerische Bearbeitung des Raumes wird im Bild selbst mittels des Modells zu Ende geführt. In der konstruktiven Veränderung des Gleichen dokumentiert sich der künstlerische Arbeitsprozess. Die gleichzeitige Präsentation zeitlich aufeinander folgender Überlegungen als homogenes Gebilde im Bild wird zur künstlerischen Antwort auf den Ausstellungsbereich selbst.
Vor diesem Hintergrund können die Gipsfragmente als eine mögliche Veränderung, als Andeutung des Verhüllens, Verfremdens und Hinzufügens gedeutet werden. Sie verkörpern mittels ihrer Materialität nichts Endgültiges, Dauerhaftes. Mit ihrer Plazierung geben sie dem Bild einen Rand als Abschluss in der Fläche und ein artifizielles Gegenüber, durchaus auch im Sinne einer optischen „Flurbereinigung“, indem sie die durch Abdeckung und Fussleiste gestaltete Brüstung zu einem geometrisch klaren, edel gearbeiteten Körper formen. Ihre Ausrichtungen wollen ebenso wie das Bild abgeschritten oder umlaufen werden. Denn „Modell Hattingen“ hat kein Zentrum, sowie das Treppenhaus eine Verbindung von Stufen und Fluren über die Etagen ist.
Als wolle Carsten Gliese seine bisherigen künstlerischen Mittel einer Prüfung unterziehen, scheint er die Idee zu der Installation in der Reflexion seiner Arbeitsweise gefunden zu haben. Seine wirklich handgreifliche Art, im Modell mit Architektur umzugehen, sie sich regelrecht zu eigen zu machen, darin umzustrukturieren und in ein Kunstwerk zu übersetzen, formuliert er als durchaus „brüchige“ Korrespondenz einer virtuellen Raumvorstellung mit einer raumgreifenden Komposition, die in dem Treppenaufgang im Stadtmuseum Hattingen ihren motivisch angestammten Ort hat.
Die technische Voraussetzung zum bildhaften und bildwürdigen Ausdruck seines künstlerischen Denkens, manifestiert im Wandel des Modells, hat Carsten Gliese im Computer entdeckt. Hier hat er einen Weg gefunden, die Fotografie, von der er eigentlich kommt, als dokumentarische Vorlage für eine hochgradig ästhetisierende Bildbearbeitung wieder in das Zentrum seiner Arbeit zurückzuführen.
„Modell Dortmund II“ (2001) zeigt ein zweiteiliges farbiges Deckenbild in dem Verbindungsflur zwischen Foyer und Ausstellungsräumen des Künstlerhauses Dortmund. Das zusammengehörige Motiv der Fotodrucke organisiert wiederum eine Montage von Ansichten eines masstäblichen Pappmodells eben dieses Flures. Aus vier verschiedenen Perspektiven ist ein Ausschnitt mit dem Deckensturz zu sehen, der selbst als reale Architektur die Fotodrucke trennt.
Die Einzelbilder, die aus der Drehung der Kamera im Modell um den Sturz entstanden sind, gestaltet die Bildbeabeitung zu einer rhythmischen Abwicklung, in der der Sturz wiederholt sich über die Wände spannt und dabei sein architektonisches Vorbild wie selbstverständlich in die Komposition integriert. Diesen Eindruck bestätigt auch die gestaffelte Wiederholung des doppelten Wandvorsprungs, der sich als Verlängerung der Wand auf einer Seite terrassenförmig fortsetzt. Dabei behauptet sich das Bild in den warmen Brauntönen als motivische Fortsetzung der Architektur im Irrealen. Zu einer der Kopfwände hin wechselt im Motiv unvermittelt der Lichteinfall und die Perspektive. Ein wie im Traumbild aus dem Lot geratener enger Raum scheint sich über die Wand zu schieben und der nach oben in die Ortlosigkeit des weissen Hintergrundes laufenden Konstruktion ein Ende zu setzen. Hier richtet sich der Blick in die Enge des Flures selbst. Durch den Perspektivwechsel wird mit dem Verweis auf die eigentlichen Verhältnisse die Illusion luftiger Grenzenlosigkeit gebrochen und das Architekturensemble als ein nur im Virtuellen existierendes verortet.
Wie im „Modell Hattingen“ hat der Künstler sich seine Bildvorlage nach der Architektur im Modell geschaffen. Sein Stilmittel ist auch hier das der Freistellung und Montage der fotografierten Objekte. Ihre hyperrealistische Anmutung gewinnen sie neben der Vergrösserung aus der brillanten fotografischen Ausleuchtung und der Präzision bei der Bildbearbeitung.
„Modell Dortmund II“ gehört gewiss nicht zu den grössten, aber vielleicht zu den einfühlsamsten Arbeiten von Carsten Gliese. Es ist beeindruckend, wie er in der Tradition illusionistischer Deckenmalerei in diesem Flur, der nur hoch und schmal ist und eher verbaut wirkt, einen simplen Deckensturz zur Attraktion erhebt. Seine Himmelsarchitektur, gebaut aus dem Banalen, verwandelt den kleinen Flur in ein spektakuläres Kabinett des architektonischen Sehens.
Mit seinem Beitrag zu „direttissima“ (2001) und der Ausstellung im Atelierhaus, Hafenweg 22, (2002) realisierte Carsten Gliese zwei Arbeiten im Aussenbereich, die sich beide auf ein freistehendes Treppenhaus beziehen.
Bei „direttissima“ verhängt er mit der monumentalen Fotografie einer Modellarchitektur die Frontfassade des Treppenhausturmes in einem Wohnkomplex. Als überlängtes Hochformat zeigt die Fotoplane das Fragment eines stark vergrösserten Pappmodells mit einer Treppensituation auf zwei Ebenen. Die reduzierten Architekturformen sind jedoch nicht als massstäblicher Entwurf eines funktionalen Gebäudes konzipiert, also auch nicht von der Architektur ihrer Plazierung abgeleitet. In dem Motiv der Treppe liegt die Berührung zwischen Architektur und autonomer Modellvorstellung.
Der vorgelagerte Treppenhausturm verbindet mit seinem trapezförmigen Grundriss zwei Wohnblöcke, die sich von ihm wie an einem Gelenk symmetrisch nach hinten abwinkeln. An dieser Schnittstelle imaginärer Bewegung und Öffnung stellt der dokumentarische Charakter der S/W-Fotografie mit dem schmalen Einblick in eine Phantasiearchitektur die Fassade als die eines Wohnhauses in Frage. Kann die untere Etage noch als merkwürdig proportionierter Treppeneingang interpretiert werden, der trotz des hohen Betrachterstandpunktes über dem eigentlichen Eingang in das Treppenhaus eingebunden zu sein scheint, tendiert auf der zweiten Ebene der Kanon der durch die Bildgrenzen beschnittenen Architekturzitate zur Abstraktion. Das Modell setzt seinen eigenen Massstab, den es auch in der extremen Vergrösserung gegenüber seinem Umfeld behauptet. Die Fassade wird gleichsam von der Vision eines disfunktionalen Raumes hinterwandert, der in der Ästhetik des skizzenhaften Modells scheinbar von innen ihre Grenzen sprengt.
Mit der Konzeption dieser Arbeit, ebenso wie bei der folgenden, konfrontiert Carsten Gliese das Gebäude nicht über den Transfer im Modell mit sich selbst, sondern nutzt die spezifische architektonische Situation, dem Gebäude über die illusionistische Wirkung des Bildes ein fremdartiges Innenleben einzuschreiben. Es wäre unsinnig, in seiner mit solcher Klarheit inszenierten optischen Integration eine Idee der Verbesserung im Sinne einer Architekturkritik zu sehen. Er sensibilisiert die Wahrnehmung für das Volumen, die Funktion und durchaus auch für die Schönheit von Architektur. Dabei stellt er konsequent immer wieder neu die Frage nach der Perspektive, aus der heraus man sie betrachtet. In seinen Arbeiten visualisiert sich ein anderes Sehen auf das, was man gemeinhin als gebaute Realität bezeichnet. Es liegt in der Vorstellungskraft des Betrachters, über den ästhetischen Genuss mittels des im Modell vorgestellten Zitats eine gedankliche Neuorganisation der vorhandenen Architektur aus ihren formalen Gegebenheiten zu versuchen.
In dem verglasten Treppenhaus des Atelierhauses, Hafenweg 22, hinter das sich das Gebäude wie ein Riegel schiebt, hat der Künstler über die fünf Etagen ein S/W-Hinterglasbild aus Papier geklebt. Zu sehen ist wiederum in starker Vergrösserung eine Treppensituation im Modellbau, die jedoch, anders als bei „direttissima“, sich nicht als ein einheitliches Abbild präsentiert. Links unten schraubt sich über zwei Stufen ein Aufgang hinter den eigentlichen Eingang. Darüber hängt freischwebend eine zum Treppenhaus quer ausgerichtete Treppe, die sich im rechten Winkel mit einer weiteren verbindet. Diese wird ungefähr auf Höhe der Mitte des Gebäudes mit einer Brüstung unvermittelt abgeschlossen. Links von ihm ragt eine isolierte Wand auf der Mittelachse des Motivs beinahe bis an das Dach. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, das die beiden sich verbindenden Treppenelemente ein und dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven sind, so wie die nach oben führende Wand im Fragment gleich einer Brüstung auch unten auftaucht. Dies ist in erster Linie an dem irritierenden Element zu erkennen, das als Modell im Modell eingebettet ist. Es handelt sich dabei augenscheinlich um die Verschalung eines Handlaufes mit dem Stück Wand darunter und einem Teil der Treppe, die bei der Verschalung um die Hälfte der Stufen reduziert wird. Damit wird das Modell als ein Arbeitsmodell ausgewiesen, in das geplante Eingriffe installiert wurden. Doch scheint hier nicht der Ort zu sein, an dem das stattfinden soll.
Die Glasfront ist nicht vollständig durch das Bild abgedeckt. Die Modellansichten türmen sich wie Baukörper übereinander und gewähren neben und in ihrem Gefüge Einblicke in die Betonarchitektur des Treppenhauses. Ausschnitte der Wirklichkeit werden zum Bestandteil der Bildkomposition. Personen, die durch das Treppenhaus laufen verschwinden für den aussenstehenden Betrachter gleichsam in der verschachtelten Ordnung. Die Profile der einzelnen Glasscheiben gliedern das Bild in gleichgrosse Segmente. Wie eine systematische einverleibende Rasterung, erwachsen aus dem Bauprinzip des Atelierhauses, legen sie sich über das Motiv, dem der Betonmantel des Treppenhauses als gewaltiger Bilderrahmen.eine äussere Fassung gibt. Wie sehr der Künstler diese Installation als Bild begreift, zeigt sich auch daran, dass drei in Grauabstufungen gehaltene Winkel, von denen nur der obere durch eine Ahnung von Schatten belebt wird, das Motiv regelrecht mit geometrisch-abstrakten Formen verklammern.
„Modell Münster“ (2002) ist das bislang einzige Werk von Carsten Gliese, das fest installiert an seinem Ort verbleibt. Für die Sparkassenakademie Münster hat der Künstler einen Bildteppich entworfen und in der Brücke zwischen zwei Gebäudekomplexen verlegt. Es handelt sich um einen verglasten, dem Gebäude vorgelagerten Gang, der leicht ansteigend das Foyer mit dem Hotelbereich verbindet.
Das Motiv des Teppichs zeigt eine Montage aus computerbearbeiteten S/W-Fotografien vornehmlich aus dem Vorraum zur Kantine, den man über diese Brücke erreicht. Es sind in den Grössenverhältnissen und Perspektiven wechselnde, fotografisch freigestellte Situationen der Architektur vor einer dunklen Fläche. Gleich zu Beginn empfängt ein Bild der geöffneten Doppeltür den Betrachter, durch die er gerade den Flur betritt. Sie schwebt über und vor einem Ausschnitt des Teppichs mit weiss punktierter Musterung, den der Bildteppich jetzt in dem Gang ersetzt und der auch in dem Bereich ausgelegt ist, aus dem seine weiteren fotografischen Einzelmotive stammen. Über die Tür fällt der Blick auf das runde abschliessende Geländer einer Wendeltreppe, das der Architekt als Blickfang über die Mittelachse der Brücke in dem Vorraum plaziert hat. An diese Bildkonstellation, die gleichsam die räumlichen Koordinaten seiner bildlichen Raumabwicklung markieren, fügt Carsten Gliese, einem Legespiel gleich, Architekturzitate aneinander. Fragmente des Teppichbodens schweben wie grosse geometrische Inseln auf verschiedenen Ebenen vor- und nebeneinander. Dazwischen stellen sich Wände aus Naturstein, bauen sich Pfosten auf, öffnen sich unvermittelt Türen in eine tiefe Raumflucht oder stehen verschlossen wie ein rechteckiges Blatt im Motiv. Eine schwarze Fussleiste zieht sich in Form einer Linienzeichnung über das Bild. In der mittleren Partie verläuft sie in Gestalt eines schmalen Steges zwischen den Inseln und überbrückt die Kluft zwischen den Architekturelementen. In der Bilderscheinung vergleichbar flankiert sie ein schmaler Ausschnitt der Deckenfläche, der durch die serielle Anordnung der Beleuchtungskörper als hell gepunkteter Streifen eine formale Analogie zu dem Teppichmuster aufweist. Am Ende der Motivkette, also beim Verlassen des Ganges, richtet sich die Perspektive aus der Ferne zurück in den Glasflur.
Bei der Komposition seines Bildteppichs hat Carsten Gliese die fotografische Erfassung des Vorraumes derart abgewickelt, dass die abgebildeten Segmente, wenn man sie sprachlich bezeichnete, folgerichtig aufeinanderträfen: „Der Deckenstreifen stösst hier an die Wand, von der aus die Fussleiste zu dieser Tür führt, die über dieses Teppichfragment mit jenem Pfosten verbunden ist... Da jedoch zu der Konstellation ein verbindlicher Betrachterstandort fehlt, der Perspektivwechsel beim fotografischen Schuss und Gegenschuss in der Montage eine Trennung zwischen oben und unten, rechts und links aufhebt, und zusätzlich eine Grössenverschiebung im Spiel auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, übersteigt die komplexe Raumbeschreibung das Abstraktionsvermögen. Obwohl alles im Detail zu identifizieren ist, gelingt es nicht, sich aus der Motivkette den abfotografierten Raum zu einem einheitlichen Ganzen zu rekonstruieren.
In die lichte feingliedrige Stahl- und Glasarchitektur der Brücke hat der Künstler eine ebenso filigrane Architekturinterpretation als begehbares Bild installiert. Mit einer grandiosen Komposition rollt er einen Bereich des Gebäudes gleichsam aus und stellt unsere Sehgewohnheiten damit buchstäblich auf den Kopf. Diese Installation ist für die Leute gemacht, für die die Akademie gebaut wurde - die Benutzer eben, die diesen Flur mehrfach durchqueren und im Überlaufen des Bildteppichs immer präziser Abbildung und Erinnerung an den Vorraum übereinbringen und dadurch „Stück für Stück“ intuitiv mehr von seiner inneren Ordnung verstehen.
Es ist ein modellhaftes Denken, das Carsten Gliese mit seinen in grosser Genauigkeit ausgeführten Installationen anstösst. Sein künstlerisches Interesse gilt der Architektur, die über ihre Funktion und Dimensionierung geometrischen Raum und Lebensraum gleichermassen definiert. In einem künstlerisch motivierten analytischen Vorgehen beginnt er über Modelle und Fotos Architektur zu sezieren, um darin eine Bildsprache oder Gestaltung zu finden, die sich nicht als Gegenbild, sondern als transformiertes Bild der Architektur in dieselbe einfügt. Eine Besonderheit seines Zugriffs liegt in der Bedeutung, die er dem Bruch in der Perspektive bei der Darstellung von Architektur beimisst. Es ist ein differenziertes Spiel mit dem einzunehmenden Standort und der Idee der Bewegung, in der sich der Raum erst erschliesst. Diese wird folglich immer zu einem Aspekt und zum Gegenstand der Reflexion bei der Betrachtung seiner Installationen. Nicht von ungefähr wählt er als Ausgangspunkt häufig architektonische Situationen des Übergangs wie Flure, Treppen, Vorräume etc. Carsten Glieses Interventionen sind in sich schlüssige Gestaltungen, die allein durch ihre ästhetische Präsenz schon einen überwältigenden Eindruck hinterlassen können. Aber sie wollen nicht nur als imposante Verfremdungen der Architektur gelesen werden. In ihnen lebt die Idee ständiger Erneuerung und Veränderung, die das aktive Sehen von Architektur gleichermassen wie die Befragung dieses Sehens betrifft.
Während eines Ausstellungsaufbaus meinte er: „Irgendwie arbeitet man die Orte einfach so ab.“ Das ist richtig. Jeder Ort stellt sich ihm mit einer einzigartigen Fragestellung, die er intuitiv erspürt und als Architektur der imaginären Vereinnahmung modelliert. Deswegen hat die Floskel der „raumbezogen Arbeit“ bei ihm substantiellen Sinn.
Ins Verhältnis-Setzen: Domestizieren
Eröffnungsrede von Volker Pantenburg im Kunstverein Ahlen, 2004
Die Ausstellung mit Arbeiten von Carsten Gliese und Matthias Müller, die heute hier im Kunstverein Ahlen eröffnet wird, trägt zwei Titel: Sie ist einerseits Bestandteil einer vierteiligen Reihe - "Ins-Verhältnis-Setzen" - und andererseits mit dem Begriff "Domestizieren" überschrieben. Noch bevor man die einzelnen Arbeiten in den Blick nimmt, ist man also aufgerufen, das Motto der Reihe ernst zu nehmen: Zwei Dinge in Beziehung miteinander zu bringen, Relationen herzustellen. Zwischen den beiden Künstlern, zwischen den Arbeiten und uns als Zuschauern, vor allem aber zwischen Bildern und Räumen - häuslichen und öffentlichen, Räumen der Intimität und solchen der Exposition. Damit sind Fragen des Transfers und der Übersetzung angesprochen, die für beide Künstler zentral sind: Welche Bild- und Gedächtnisräume entwirft der Film? Welche Raumbilder entwickelt die Fotografie? Und welche Rolle spielen wir als Beobachter dabei?
"Domestizieren" und "Ins-Verhältnis-Setzen": Aus den Worten ist zwar eine Aufforderung herauszuhören, aber sie sind zunächst einmal ganz neutral formulierte Verben. Man könnte sich beide Begriffe als Einträge in einem Wörterbuch vorstellen und darüber spekulieren, welche Erklärung sich dort wohl fände. Zur Erläuterung von "Ins-Verhältnis-Setzen" würde man in einem solchen fiktiven Wörterbuch menschlicher Praktiken unter Umständen auf den Begriff "Montage" stoßen. "Montage" ist - neben der verwandten Collage - nicht nur eine der zentralen künstlerischen Techniken der Moderne, die bereits in den Avantgarde Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts den Blick neu justierte und vorhandenes Material als einen schier unerschöpflichen Rohstoff für die künstlerische Arbeit entdeckte. Der Begriff verbindet vor allem die beiden Medien Film und Architektur wie kein anderer und ist deshalb ein besonders naheliegendes Scharnier zwischen den Arbeiten Müllers und Glieses. Einerseits benennt "Montage" die Praxis, Filmstücke hintereinander zu setzen und so eine Reihe von Einstellungen zu einer filmischen Erzählung zu verbinden. Andererseits - und aus diesem Bereich stammt das Wort ursprünglich, - meint es das Konstruieren von Objekten und Bauten, es beschreibt die Tätigkeit des Ingenieurs. In beiden Fällen gerät der Akt des Zusammenfügens in den Blick, und der fertige Film ist ebenso wie das fertige Objekt vor allem als Ergebnis dieser Handlung zu begreifen, als etwas Gemachtes und Konstruiertes.
***
Es gibt viele Arten, einen Film, eine Maschine, einen Schrank oder eine Schreibtisch zu montieren. Man kann gemäß der Gebrauchsanweisung vorgehen, so, dass die Dinge nach landläufiger Vorstellung "funktionieren" - so, dass der Film eine flüssige Geschichte erzählt, dass man am Tisch bequem sitzen kann oder seine Kleidung morgens mit einer routinierten Handbewegung aus dem Schrank holt. Interessanter, wenn auch aufwändiger und nervenraubender, ist eine Montage gegen die Gebrauchsanweisung. Eine solche Operation hat den Vorteil, dass sie die gemeinhin unhinterfragten Regeln - Regeln der Wahrnehmung, der Filmerzählung, der Konvention, wenn man so will: "Hausordnungen" des Blicks - überhaupt erst sichtbar macht. Dieser Wunsch, die ungeschriebenen Gesetze im Akt ihrer Überschreitung sichtbar zu machen, verdankt sich einer experimentellen Neugier und verbindet die Arbeit des Wissenschaftlers mit der des Künstlers.
***
Ich will das zunächst anhand der Objekte von Carsten Gliese kurz beschreiben. Seit mehr als zehn Jahren umkreisen seine Arbeiten - immer auf spezifische Orte bezogen - das Problem der räumlichen Wahrnehmung und seiner zweidimensionalen Repräsentation. Fotografien bilden den Ausgangspunkt seiner Raumobjekte und provozieren erste Fragen: Was geht bei der Abbildung eines dreidimensionalen Raums verloren? Wie lassen sich diese Verluste gewinnbringend in den Raum zurückspiegeln? Als die Fotografie vor mehr als einhundertfünfzig Jahren erfunden wurde, übersetzte sie die seit der Renaissance bekannten Regeln dafür, wie eine räumliche Darstellung auf eine zweidimensionale Fläche zu übertragen sei, in eine technische Apparatur, sie verwandelte ein Bildprogramm in einen Apparat, machte aus Software Hardware. Dass diese Apparatur nicht natürlich ist, sondern auf einer Reihe von konventionalisierten Regeln beruht, wird leicht vergessen. Als Picasso einmal von einem Kritiker gefragt wurde, warum er die Dinge nicht so malen könne, wie sie wirklich sind, so, wie zum Beispiel hier seine Frau auf diesem Foto aussehe, antwortete Picasso lakonisch: "Sie ist aber sehr klein. Und auch ziemlich flach." Soviel zum naiven Realismus, den das Medium herauszufordern scheint.
Was die Abbildung von Räumen in der Fotografie angeht, so basiert sie auf einem geläufigen Prinzip: Von einem definierten Beobachterstandpunkt aus täuscht eine nach festgelegten Projektionsregeln gezeichnete (oder fotografierte) Fläche einen Tiefeneindruck vor, der vom Betrachter automatisch und unbewusst verstanden wird. Wir ergänzen also die Fläche - aufgrund der Domestiziertheit unserer Augen - automatisch wieder zu einem dreidimensionalen Raum. Strenggenommen betrachten wir das Foto dabei nicht im materiellen Sinne als Foto, sondern als eine Art durchsichtiges Fenster zur Welt.
Carsten Gliese dagegen operiert - hier wie in anderen Arbeiten - mit einer, wie er es nennt: "kontrollierten Blindheit". Er nimmt die Fotografie als das, was sie ist: als eine Fläche, die aus Abstufungen von Farbe, Einzelflächen, Schatten und Formen zusammengesetzt ist, die zunächst einmal gleichwertig und damit variabel montierbar sind. Das Foto ist für ihn eine Art Schnittmuster, und was den vermeintlichen Hintergrund abgibt, hat die gleiche Relevanz wie die "eigentlichen" Motive. Beim Prozess, aus diesem Schnittmuster einzelne Formen selektiv herauszutrennen und auf Pappe zu übertragen, entsteht ein Puzzle von Einzelteilen, die nun nach neuen Kriterien rekombiniert, miteinander ins Verhältnis gesetzt und im Raum verteilt werden können. Die so entstehenden räumlichen Objekte sind als "montiert" zu verstehen, weil sie eine Verschränkung zweier Orte darstellen, Orte, die als eine merkwürdig verzerrte und verfremdete Spiegelung des Ausgangsraums verstanden werden kann. Genauer müsste man sagen: als die Verschränkung mehrerer Blicke und Perspektiven. Ein solches Projekt knüpft an konzeptuelle und minimalistische Strömungen der Sechziger Jahre an, die sich vom Autor-Subjekt zu verabschieden suchten, indem sie mathematische Kalkulation und im Vorhinein festgelegte Regeln an die Stelle des genialen Künstler-Subjekts setzten. Auch die Verwendung von industriell gefertigter Pappe lässt an jemanden wie Donald Judd denken, der für seine "Specific Objects" auf seriell produzierte Bleche und Materialien zurückgriff. Andererseits hält sich Gliese keineswegs aus dem Prozess heraus, sondern wirkt von der Fotografie über die Auswahl von Flächen bis hin zum Bau der Objekte als Entscheidungsträger mit. Die Objekte sind also - zugespitzt formuliert - auch als autobiographische Dokumente eines Blicks zu lesen, mit dem wir unseren Blick in der Ausstellung abgleichen können.
Der Begriff der Domestizierung kommt dabei, neben der Neubewertung unseres konventionalisierten Blicks auf Fotografien, noch auf einer naheliegenderen Ebene ins Spiel. Denn für diese Ausstellung hat Carsten Gliese Gegenstände aus seiner eigenen Wohnung in Objekte "übersetzt". Geht er in seinen bisherigen Arbeiten meist von dem Ausstellungsraum selbst aus, der, in Fotografien übertragen, als Basis für die weitere Erstellung von Modellen dient, sind es nun Möbel, die er zuhause fotografiert hat: "Stuhl", "Tisch", "Tür", "Wandschrank". Die jeweiligen Ausgangsmodelle sind in den Objekten jedoch nur noch schwer zu erkennen. Durch die zweifache Übersetzung haben sie Deformationen erlitten und die Patina von Biographie und Erinnerung abgelegt. Louis Sullivans bekanntes Credo moderner Architektur "Form follows function" ist hier insofern ironisch umformuliert, dass es in Glieses Arbeiten höchstens noch zeitlich zu verstehen ist: Funktion verabschiedet sich zugunsten von Form.
Raumreflexionen
Begleittext aus dem Katalog "Modell Osthaus" von René Hirner, 2006
Die künstlerische Reflexion und Verwandlung vorhandener architektonischer Räume und Gebäude ist das Thema, mit dem sich Carsten Gliese seit mehr als zehn Jahren beschäftigt. So hat er in dieser Zeit mehr als zwei Dutzend Installationen geschaffen, die jeweils den architektonischen Ort ihrer Präsentation selbst zum Gegenstand haben. Durch diese Verschränkung realer Räume mit ihrer künstlerischen Repräsentation hat Carsten Gliese räumliche Inszenierungen von höchster Selbstreflexivität geschaffen, die einen wesentlichen Anspruch moderner Kunst – nämlich die Reflexion der künstlerischen Mittel im Kunstwerk selbst sichtbar zu machen – geradezu vorbildlich einlösen. Erinnert sei hier an Kasimir Malewitsch’ epochemachendes Bild „Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund“ von 1915, das gerade dadurch, dass es das Verhältnis von Bildfläche und Bildfigur grundsätzlich in Frage stellte, eben dieses Verhältnis als Grundlage aller Malerei sichtbar und reflektierbar machte.
Nun würde Carsten Gliese selbstverständlich nicht für sich in Anspruch nehmen,
die Verschränkung realer Architekturräume mit ihrer künstlerischen Repräsentation als Erster erfunden zu haben. Diese Entdeckung war vielmehr einer älteren Generation vorbehalten. In der Kunstwissenschaft verbindet man sie vor allem mit dem Namen von Gordon Matta-Clark (1943–1978), der ähnliche künstlerische Eingriffe schon in den 1970er Jahren durchgeführt und damit nachfolgende Künstlergenerationen beeinflusst hat. Deshalb wird Carsten Gliese häufig zusammen mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern wie Andrea Zittel, Tobias Rehberger und Joep van Lieshout genannt, deren klare konzeptuelle Strategien sich ebenfalls mit einem genuinen Interesse an unserer heutigen Alltagsarchitektur verschränken. So baut Andrea Zittel Prototypen serieller Wohneinheiten, die den Gedanken des Reihenhauses als normierter und optimierter Lebensraum durch konsequente Reduktion zuspitzen und reflektieren. Joep van Lieshout überträgt dagegen das modulare Prinzip der Minimal Art auf seine Mobilhomes, die zu mobilen und stets erweiterbaren Wohneinheiten werden. Und Tobias Rehberger interessiert sich vor allem für das Design der 1970er Jahre, das ihn zu phantastischen und gleichwohl präzise inszenierten Wohnlandschaften inspiriert.
Von ihnen unterscheidet sich Carsten Gliese vor allem durch die strenge Ortsgebundenheit seiner Inszenierungen und deren hohe Reflexivität. Letztere gründet hauptsächlich in seinem spezifischen Umgang mit der Fotografie. Denn Gliese nutzt das Medium nicht nur zur dokumentarischen Erfassung der Räume, auf deren Basis er dann seine installativen Eingriffe entwickelt und anschließend auch dokumentiert. Vielmehr nutzt er die fotografischen Bilder auch, um diese Räume selbst im Raum als Bild – also zweidimensional – zu repräsentieren.
Beispielhaft für diesen Ansatz ist eine frühe Installation, die der Künstler 1993 noch als Student an der Kunstakademie Münster realisiert hat. In einem schlichten Ausstellungsraum macht er von einem Punkt in Augenhöhe eine fünfteilige Aufnahme, die in einem 180 Grad Schwenk vom Boden an einer Wand bis zur Decke der nächsten Wand reicht. Die jeweiligen Bildausschnitte montiert er anschließend in verkleinerter Form an die entsprechenden Stellen im Raum. Allerdings nicht direkt auf die Wände selbst, sondern auf weit von den Wänden abstehende Bildträger, deren pyramidale Form die Sehpyramide der jeweiligen Bildausschnitte genau wiedergeben. Durch diese Arbeit bildet er also den fotografischen Blick als plastische Form im Raum nach und verändert dadurch zugleich die plastische Form des Raumes selbst.
Die sich aus diesem Prinzip ergebenden Möglichkeiten hat er seitdem konsequent weiterverfolgt. So macht er für den Kunstverein Gelsenkirchen 1997 aus Pappkarton und Digitaldrucken eine „Zwischenebene“, welche die Situation im Treppenhaus des Gebäudes reflektiert. Zwischen den drei Stockwerken des Aufgangsbereichs platziert, wirkt die tischartige Skulptur vom Erdgeschoss aus betrachtet, wie eine Art Tier mit vier Beinen und einem merkwürdig gezackten, flachen Körper, der entfernt an ein Krokodil denken lässt. Vom Zwischengeschoss aus gesehen, erinnert sie tatsächlich an einen merkwürdig geformten Tisch aus Architekturelementen, während von oben betrachtet, sich die merkwürdige Form schließlich klärt. Denn von oben sieht man nun, dass Carsten Gliese die Architekturform des Treppenaufgangs von oben fotografiert, vergrößert und als Grundriss für die „Tischplatte“ verwendet hat. Elemente des realen Raums, also des Treppenhauses, erscheinen sowohl als architektonisch-skulpturale Form als auch als fotografisches Abbild. Im Unterschied zur Arbeit von 1993 hat das fotografische Abbild jedoch nicht mehr die klassische Rechteckform eines Bildes, sondern wird auf die Umrissformen des abgebildeten Gegenstandes, also des Treppenaufgangs, zurechtgeschnitten. Außerdem ist es auch nicht mehr als reine Bildfläche aufgefasst, sondern wird zu einer Art Relief, das die plastischen Elemente des Treppenaufgangs auch plastisch wiedergibt.
In der Gelsenkirchener Arbeit hat Carsten Gliese damit zwei neue Elemente eingeführt, die er in seiner Installation für den Heidelberger Kunstverein im Jahr 2000 in reiner Form weiter entwickelt. So benutzt er auch hier Architekturelemente aus dem realen Raum als „Motiv“, die er durch eine Drehung in den Raum „projiziert“. In diesem Falle ist es die Stützenform für die Empore und des darunter befindlichen Wandbereichs in der Ausstellungshalle, die er in Originalgröße nachbaut und ähnlich einem zerlegbaren Stellwandsystem im Raum neu kombiniert. Durch die Bemalung in kühlem Taubengrau unterscheidet sich dieses Element genügend von der realen Architektur, um nicht mit dieser verwechselt zu werden. Durch die Zerlegung, Verdrehung und das Zusammenschieben dieser Elemente entsteht darüber hinaus eine rhythmische Raumfolge, die – beim Durchschreiten des Ausstellungsraums – immer neue und faszinierende Durch- und Ausblicke gewährt.
An dieser Installation wird die Arbeitsweise und die Wirkung deutlich, welche die Gliese’schen Rauminterventionen entfalten. So sucht sich der Künstler zunächst stets bestimmte Architekturelemente, die ihm charakteristisch erscheinen, um sie dann als fotografische Bilder oder plastische Formen zu reproduzieren, die er – in unterschiedlicher Weise gespiegelt – in den vorhandenen architektonischen Kontext integriert. Was dabei herauskommt, ist eine Verfremdung des Raumes durch dessen eigene architektonische Elemente, die eben dadurch den Betrachter erst für dessen Besonderheiten sensibilisieren. Im Unterschied zu den Arbeiten von 1993 und 1997 ist die Abbildung der gewählten Architekturelemente in der Heidelberger Arbeit aber nicht mehr fotografischer, also bildlicher Natur, sondern plastischer Art.
Doch damit wendet sich Carsten Gliese nun keineswegs von der Fotografie als Medium der Abbildung und Reflexion seiner Rauminterventionen ab. Im Treppenhaus des Stadtmuseums Hattingen bringt er 2001 sowohl plastische als auch fotografische Elemente zum Einsatz. So besteht diese Arbeit aus Gipsreliefs, mit denen er Teile der Wände verkleidet, und einer riesigen Fotoleinwand, welche die gesamte Wand des Flures bedeckt. Dieses Mal bildet die Fotografie jedoch das beherrschende Architekturelement dieser Raumsituation, den Z-förmigen Treppenaufgang, nicht einfach ab, sondern zeigt es in vier verschiedenen Perspektiven und Zuständen. Dafür hat Carsten Gliese den Treppenaufgang eigens als Pappmodell nachgebaut und dessen Entstehung fotografisch dokumentiert. Für die riesige Fotowand hat er diese Fotos schließlich so collagiert, dass ein illusionistisches Bild entsteht, welches das Z-förmige Architekturelement in unterschiedlichen Perspektiven und Zuständen als eine Art surrealistische Raumskulptur zeigt. Damit nutzt er die Fotografie erstmals nicht mehr primär zur Abbildung bestimmter Architekturelemente, sondern als Medium für die Erfindung neuer, fiktiver Bildräume. Dabei handelt es sich zwar um Bildräume in der strengen Formensprache der 1960er und -70er Jahre Architektur, aber letztlich sind es Architekturphantasien, die an die illusionistische Raummalerei des Barock denken lassen.
Die illusionistische Erzeugung eines architektonischen Raums hat der Künstler in
der Reihe seiner „Zwischenbebauungen“ weiter geführt, in denen er ebenfalls plastische und bildliche Elemente mit einander kombiniert. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die „Zwischenbebauung III“, die er 2002 im Treppenhaus eines Atelierhauses in Münster realisieren konnte. Die durchgängig verglaste Frontseite dieses Treppenhauses ermöglicht es ihm, über fünf Etagen hinweg ein durchgängiges Hinterglasbild aus Papier zu kleben, das illusionistisch eine Treppensituation wiedergibt. Bei genauerer Betrachtung gibt dieses Bild zu erkennen, dass seine Architekturelemente aus der real existierenden Architektur des Treppenhauses abgeleitet sind. Das riesige Hinterglasbild stellt somit eine illusionistische Verfremdung der realen Architektur dar und löst damit beim Betrachter dieselben Prozesse der Sensibilisierung und Reflexion aus, wie sie bei allen Arbeiten des Künstlers zu konstatieren sind.
Keinen Innenraum und auch keine seiner bevorzugten Treppenraumsituationen fand Carsten Gliese 2004 beim Bildhauersymposion Heidenheim vor. Vielmehr arbeitet
er hier erstmals auf einer Außenfassade, die – im Unterschied zu Münster – über drei Schauseiten verfügt. Auf die bekannte Weise entwickelt er aus den real vorhandenen Architekturelementen ein illusionistisches Architekturbild, das sich jetzt über zwei Seiten des Gebäudes zieht. Die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Gebäudeseiten nicht direkt aufeinander treffen zu lassen, löst er dabei raffiniert, in dem ihre gemeinsame Eckelinie zum Fluchtpunkt der beiden gegenläufigen Bildperspektiven macht. Neu ist auch das Material, mit dem er das Bild auf den Außenwänden anbringt: Es handelt sich um frei vor die Wände geschraubte Lochbleche, deren Bohrungen das fotografische Raster seiner Bildvorlage wiedergeben. Da die Bleche dunkel sind und die Bohrungen den Blick auf die helle Betonfassade freigeben, entstehen abhängig vom Standpunkt des Betrachters und von den wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich kontrastierende und unterschiedlich scharfe Raumillusionen. Damit gelingt Carsten Gliese „ein fast barocker Illusionismus vereint mit einer virtuos eingesetzten Kenntnis moderner architektonischer Formensprache“ (Sabine Maria Schmidt), dem – auf Grund der wechselnden Lichtverhältnisse – zugleich etwas Relativistisches und Transitorisches anhaftet.
Die Abhängigkeit der Bild- und Raumwahrnehmung vom Licht thematisiert der Künstler in einer Reihe von jüngst entstandenen Fotoarbeiten. Es sind autonome Raumaufnahmen, die er durch eine bewusste Lichtregie verfremdet. So zeigt beispielsweise das Foto „Tür IV“ den Innenraum eines Ateliers, in das ein WC-Block eingebaut wurde. Dessen weit geöffnete Tür wird durch ein rechteckiges Lichtfeld so beleuchtet, dass ihr Schatten einen Raum erzeugt, dessen Proportionen mit denen des WC-Blocks korrespondieren. Da der Künstler mit seinem Lichtfeld nur die Tür und einen Teil des Raumes ausleuchtet – was er u. a. durch die Mehrfachbelichtung eines Negativs bewerkstelligt –, entsteht ein Raumbild, das sich aus fast immateriell wirkenden weißen Flächen und unterschiedlich stark belichteten Raumteilen zusammensetzt. Die Wirkung dieser Fotografien ist so einfach wie bestechend. Denn sie machen das Licht als Voraussetzung jeder Raumwahrnehmung sichtbar und zeigen dessen unterschiedliche Qualitäten: Vom reinen, blendenden Weiß, das nichts erkennen lässt und letztlich nichts anderes als die reine weiße Fläche des Fotopapiers zeigt; über strahlendes Weiß, das aber noch Konturen preis gibt; bis zu starkem Licht, das den Raum, die Wände und Dinge mitsamt ihren Oberflächentexturen sichtbar macht. Vom leichten Schatten, der keinen Hinweis auf den Standort der ihn erzeugenden Lichtquelle gibt, bis zu fast ganz dunklen Stellen, die Räumlichkeit und Gegenstände kaum mehr erkennen lassen. Die fotografische Aufnahme wird somit als ein Bild wahrnehmbar, das einerseits aus der zweidimensionale Fläche des weißen Fotopapiers besteht und andererseits in allen Abstufungen zwischen Weiß und Schwarz die illusionistische Abbildung des Raumes ermöglicht.
Was eingangs als ein Hauptcharakteristikum von Carsten Glieses Kunst konstatiert wurde, ist also auch in seinen jüngsten Fotoarbeiten zu beobachten. Es ist die konzentrierte künstlerische Auseinandersetzung mit konkreten Räumen, die durch die konsequente Verschränkung von deren Realität mit ihrer künstlerischen Repräsentation Werke hervorbringt, die sowohl ihre Gegenstände (dies sind: die architektonischen Räume) als auch ihre künstlerischen Darstellungsmittel (dies sind: Licht und Fotografie) wechselseitig erhellen. Selbst im Medium dieser autonomen Fotografien, die nicht mehr eines konkreten Raumes zu ihrer Präsentation bedürfen, kann der Künstler also die Selbstreflexivität seines konzeptuellen Ansatzes einlösen – und seinen Ansatz fruchtbar weiterentwickeln.
Carsten Glieses ‘Modell Osthaus’ - über Wahrnehmungsräume und Raumwahrnehmung
Begleittext aus dem Katalog "Modell Osthaus" von Birgit Schulte, 2006
Modell, lateinisch: das Muster
Teppich, persisch: das Ausgebreitete
Der Weg in die große Ausstellungshalle des Karl Ernst Osthaus Museums – der vorgeschriebene Ort für die raumbezogene Installation im Zusammenhang mit dem Karl Ernst Osthaus-Preis - führt im Zick-Zack-Kurs durch ein kleines Foyer, über eine breite Treppe, durch einen Gang und wieder über einige Stufen bis auf die Hallenebene. Dort trifft der Gewohnheitsblick des Museumsbesuchers zunächst auf leere, weiße Wände, lediglich durchbrochen von Öffnungen zu den umgebenden Galerie-Räumen und einem Fensterband unterhalb der Decke. Indes lenkt die ungewohnte Farbgebung eines weichen, die Schritte dämpfenden Untergrundes den Blick nach unten, auf den Boden.
Eine ausgedehnte, weinrote und sandfarbene Teppichfläche breitet sich vor den Augen aus, durchbrochen von kantigen, dunkel- und hellgrauen Strukturen und eingefaßt von einem hellen Ornamentband. Das Zentrum des Teppichbodens behauptet die sandfarbene Zone, mit einem stark zerklüfteten Rand aus stereometrischen Formelementen. Seine Mitte markiert ein dunkles, irreguläres Vieleck, dessen Form, stark verkleinert, exakt den Grundriß der Halle nachvollzieht. Die Ränder jenes inneren, sternförmigen Polygons verlaufen parallel zu den Wänden. Diese Korrespondenz verleitet zu einem näheren Vergleich zwischen dem Teppichmuster und der Hallenarchitektur. Dabei geben die variantenreichen Einzelmotive der Teppichgestaltung sich und ihren Ursprung klar zu erkennen. Nach und nach erschließen sich Details: ein Wandaufriß, eine Treppenwange, ein Scheinwerfer, ein Fensterband.
Die Sternform im Zentrum zeigt eine Ansicht der Halle aus der Vogelperspektive. Wie bei einem Bastelbogen - und ein solcher lag de facto der Ausschreibung zum Karl Ernst Osthaus-Preis zugrunde - erscheinen die Wände des Raumes nach außen geklappt. Schmale, durchbrochene Rechtecke, verbunden durch filigrane Linien, kreisen um die zentrale Sternform, wie Ringe um einen Planeten. Die feingliedrige Formenreihe dieser Rahmung geht zurück auf die Zone der Fensterbänder unterhalb der Hallendecke. An der Grenze zwischen sandfarbenem und rotem Fond schweben perspektivisch verzerrte, gelängte oder gestauchte Architekturfragmente. Die bizarren Formationen sind aus der Wandabwicklung der Halle abgeleitet, wobei dem komplexen Gefüge eine logische Konstellation zugrunde liegt: die verschachtelten Motivreihen nehmen jeweils Bezug auf die nächstliegende Wand. Außerdem grenzen, wie in der realen Architektur, immer wieder konstruktiv aufeinander bezogene Boden- und Wandstück-Formen aneinander. Lichtschienen-Motive mit Scheinwerfern oder Lüftungsgittermuster werden zu Bindegliedern zwischen kompakten Architekturelementen. Das unter der Mitte der Halle abgehängte, rasterförmige Gerüst der Beleuchtungsanlage wird auf dem Boden zu einem in sich quadrierten, hell-dunkel gemusterten Rauten-Dekor. In Richtung der Raumecken schieben sich wie Protuberanzen Vogelschau-Ansichten aus dem kreisenden Gefüge heraus, komponiert aus den achsensymmetrisch gespiegelten Wand-Boden-Ausschnitten der gegenüberliegenden Ecke. Vis-à-vis, jeweils in den Winkeln, schweben Satelliten gleich, isolierte Raumgebilde auf dem roten Fond. Ihre dreidimensionale, offene Struktur, in die man von oben hineinzublicken scheint, ist ebenfalls montiert aus den gedoppelten und gespiegelten Wand- und Bodenstücken der jeweiligen Raumecke.
In den kurzen, zur Skulpturenterrasse führenden Seitenarm der Halle, ragt eine raffinierte Formation, in der Abbildungen der oberen Galerie und deren Brüstung verarbeitet sind, flankiert von einer Ansicht des Treppenaufgangs zu den oberen Räumen. In den langen Seitenarm des Hauptraumes dringt eine lockere Folge von Architekturelementen, verklammert durch Motive von Lichtschienen, Lüftungslamellen und Fensterbändern. Verschiedene Elemente verweisen auf die Raumsituation vor der Halle: sie führen den Blick zurück in den Gang und auf die Treppenstufen mit den seitlichen Geländern, um schließlich in einem Rechteck zu enden, das wie in einem Guckkasten den Blick auf die perspektivisch zulaufende Treppe zur Halle freigibt. Mit einer sechseckigen Solitärform, kombiniert aus der gespiegelten Raumecke mit umklammernden Bodenabwicklungen, endet die Musterfolge in dem Gang. Den umsäumenden Rahmen für den gesamten Teppich bildet eine Bordüre, deren Gestaltung, sehr stark verkleinert, in fortgesetzter Reihe das Zentralmotiv der aufgeklappten Halle aus der Vogelperspektive wiederholt.
Carsten Gliese hat sich, wie es die Ausschreibungsbedingungen des Karl Ernst Osthaus-Preises formulieren, intensiv und akribisch bis ins kleinste Detail mit der Architektur der Museumshalle auseinandergesetzt. An einem Modell in verkleinertem Maßstab hat er zunächst, im Rahmen des Wettbewerbs, den Entwurf und die Realisierungsmöglichkeit seiner Grundidee erprobt. Für die Ausführung fotografierte er die Halle mit den Wandabwicklungen und technischen Einbauten vor Ort, aus allen erdenklichen Blickwinkeln und Distanzen. Der folgende Schritt im Produktionsprozeß war die Bearbeitung der digitalen Aufnahmen am Computer. Das detailreiche Foto-Puzzle wurde zu einer den Hallengrundriss ausfüllenden Bildlandschaft montiert, indem die Fragmente nach festgelegten formalen Prinzipien umgestaltet sowie an- und zueinander gefügt wurden.
Um die verwirrende Vielfalt des Teppichmusters in Augenschein zu nehmen, muß der Betrachter auf das Kunstwerk treten. Er befindet sich physisch im Bild und kann, Schritt für Schritt, auf der Bildoberfläche die fotorealistisch erfaßten Details erschließen. Die Identifikation der diversen Gebilde, die gedankliche Verknüpfung mit ihrem architektonischen Vorbild, wird dabei im steten Abgleich mit der umgebenden Architektur möglich. Dieser Wahrnehmungsprozeß erfordert Bewegung und Zeit, da das Bild mit seinem Reichtum an Motiven und Formen die komplette Grundrißfläche ausfüllt.
In der Nahsicht zeigen die dargestellten Motive eine Tendenz zur Auflösung. Die Farbfelder zerlegen sich in ein Nebeneinander von reinen, unvermischten Farbpunkten. Dieser Effekt des Divisionismus erinnert an den Neoimpressionismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Wirkung der pointillistischen Maltechnik basiert auf der optischen Fusion getrennt gesetzter Farbpunkte, die sich mit zunehmender Blick-Distanz in der visuellen Wahrnehmung mischen. Bei Glieses Bildteppich entspringt das Pointillismus- beziehungsweise Pixel-Phänomen der speziellen Produktionstechnik des Teppichs: ein Tintenstrahldrucker, dessen Skala 12 Farben umfaßt, bedruckt den Teppichflor, auf der Grundlage der vom Künstler erstellten Bild-Datei. Den einzelnen Farbpunkten auf dem Teppich entsprechen die Pixel der Bildschirm-Darstellung.
Sowohl die Farbmischung als auch das Erfassen der Gesamtkomposition bieten sich jedoch erst, wenn der Betrachter sich selbst aus dem Bild entfernt, wenn er die Bildebene verläßt, um von höher gelegenen Standorten einen Überblick zu gewinnen. Glieses Bildteppich ist von verschiedenen Erlebnisebenen aus erfahrbar. Dieser Standortwechsel ist die zwingende Voraussetzung für das Verständnis der Konzeption. Vor allem in der Übersicht kommen die Ausgewogenheit der Komposition in Bezug auf den irregulären Grundriß der Architektur sowie gleichzeitig das überbordende, nahezu barocke Moment in der Verarbeitung des reichhaltigen Motivschatzes zum Tragen. Und erst aus der Distanz wird deutlich, dass der Bildteppich traditionellen, klassischen Gestaltungselementen der Teppichkunst folgt: angefangen vom Medaillon im Zentrum, über den umgebenden Innenfond und den Außenfond mit den darin eingebetteten Zwickeln, bis hin zur umsäumenden Bordüre.
Auf die Tradition der Teppichkunst beruft sich Gliese gleichermaßen mit der Verwendung des Architekturmotivs als eigenständiges Sujet. Seit dem 15. Jahrhunderts fand die Nachbildung der eigentlich Teppichmuster-fremden Architektur Eingang in den Motivschatz der Gebetsteppiche im islamischen Raum. Das Mihrab, die Gebetsnische in der Moschee, wurde in mehr oder minder stilisierter Form in das rechteckige Innenfeld des Teppichs eingefügt, häufig flankiert oder untergliedert von zierlichen Säulen und ausgestattet mit einer unterhalb des Bogens hängenden Lichtampel. Ein außergewöhnlicher Gebetsteppich aus dem 16. Jh. bezieht zudem den Grundriß der K’aaba in Mekka ein, das Hauptheiligtum des Islam, auf das sich die Gläubigen während des Gebetes ausrichten. (Moslemischer Gebetsteppich, 16. Jh.; Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Istanbul) Auf architektonische Elemente nimmt ebenso die barocke Teppichkunst Frankreichs Bezug. So spiegelt ein großer Teppich aus dem 18. Jh. den Blick in ein Deckengewölbe mit einer zeltartigen Baldachinkuppel. (Wollteppich, Savonnerie, Ende 18. Jh., 848 x 530 cm; ehem. Wien, Österreichisches Museum für angewandte Kunst) Die Raumillusion wirkt so überzeugend, dass der Fuß beim Betreten zögert.
Auch bei Glieses Teppich wird der Betrachter herausgefordert, das architektonische Vorbild gedanklich zu rekonstruieren, zumal die Teppichgestaltung auf den ersten Blick eine dreidimensional-illusionistische Wirkung verspricht. Dieses Versprechen wird jedoch, bei eingehender Betrachtung, nicht eingelöst. Die montierten Architekturfragmente erweisen sich als hybride, virtuelle Konstruktionen, die nur als Bild möglich sind. Gerade die Diskrepanz zwischen der zum Teppich-Ornament verfremdeten Architektur und der Gestaltungsvorlage, dem realen Raum, sensibilisiert den Betrachter für die Wahrnehmung der - ihm scheinbar vertrauten - Museumsarchitektur. Erstmals werden Marginalien wie Lüftungsgitter oder Lichtschienen als Ingredienzien des Raumes wahrgenommen oder auch die weißen Wandflächen, die sonst lediglich als möglichst unaufdringlich-neutrale Hintergrundfolie ausgestellter Kunstwerke fungieren. Das begehbare Bild initiiert eine Neu-Wahrnehmung des Raumes.
Carsten Gliese konfrontiert die reale Architektur mit dem aus ihr abgeleiteten Bild und liefert eine einfühlsame und präzise Interpretation der Bauformen und der musealen Einrichtung. Die unterschiedlich manipulierten, bildlichen Raumzitate verweisen immer wieder auf ihre Herkunft. Doch obwohl dem Arrangement der Architekturfragmente an vielen Stellen eine folgerichtige Ordnung zugrunde liegt - Wand berührt Nachbarwand, grenzt an Raumecke, umschließt Bodenfläche etc. - ließe sich ohne die Kenntnis der realen räumlichen Gegebenheiten die Ausstellungshalle nicht rekonstruieren. Glieses Bildteppich ist eine Repräsentation der architektonischen Struktur der Museumshalle, ohne ihr Abbild zu sein.
Dabei könnte Glieses lückenlose, sachlich-dokumentarische Bestandsaufnahme der Museumsarchitektur mittels der Fotografie durchaus auch ein ganz anderes Ergebnis erzielen. Doch ihm dient die Fotografie als Instrument zur visuellen analytischen Durchdringung des Raumes. Sowohl die Gestalt als auch die Funktion architektonischer Merkmale werden focussiert. Auf dieser Basis lotet Gliese die ästhetischen Möglichkeiten des Raumes aus. In der darauf folgenden Bild-Synthese bleibt die fotografische Dimension mal mehr, mal weniger explizit sicht- und erkennbar.
Seit jeher fotografiert Carsten Gliese Räume, um diese zu verändern. Die Fotografie ist sowohl Analyse-Medium als auch konstituierender Bestandteil seiner architekturbezogenen Projekte. Gliese bezeichnet diese Arbeiten als ‚Modelle‘. Modell verstanden als Option, als alternativer Warnehmungs- und Denkansatz, als Aufforderung zum Perspektivwechsel in vielfältiger Hinsicht, bis hin zum freien ästhetischen Spiel.
Mit vergleichbarer Intention fand 1999 die fotografische Bestandsaufnahme des Foyers der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in Hagen, in Gestalt eines filigranen Gerüstes, Eingang in die Arbeit ‘Modell Hagen’ (s/w Digitaldruck, kaschiert auf technischer Pappe). Abgehängt unter dem gläsernen Giebel, lenkte das völlig losgelöste und unter dem Himmel schwebende Modell den Betrachterblick empor. – In der Sparkassenakademie Münster wird in dem langen Verbindungsgang zwischen zwei Gebäudekomplexen, zu Füßen des Betrachters, auf einem Teppich, die fotografische Erfassung des angrenzenden Vorraums abgewickelt. Der Bildteppich ‘Modell Münster’ (2002, Chromojet-Druck auf Teppichboden, 260 x 2350 cm) ersetzt in dem Gang einen Teppichboden, dessen Punkt-Musterung nun als Ornamentfeld die einzelnen Bildabschnitte segmentiert und hinterlegt.
Auch in der Genese von Carsten Glieses Bildteppich im Karl Ernst Osthaus Museum Hagen mit dem Titel ‘Modell Osthaus’, emanzipieren sich die Details im Prozeß ihrer Transformierung zunehmend von der Vorlage, bis sie schließlich im endgültigen Entwurf ihre eigenen ästhetischen Gesetze formulieren. Die Strukturen des realen Raumes verwandeln sich in eine künstlerische Bodenarbeit, in Form eines Teppichs. Der dreidimensionale Hallenraum wird in ein zweidimensionales Bild überführt, seine Architektur wird zum Muster. Das Muster, lateinisch ‚Modell‘, wird aus den Gegebenheiten der Halle abgeleitet und auf dem Teppich wiederum in die Halle eingebracht.
Dass Gliese sein Modell als Teppich umsetzt ist ungewöhnlich, da in der bildenden Kunst der Teppich als künstlerisches Medium kaum eine Rolle spielt. Zwar gab es im 20. Jahrhundert zur Zeit des Jugendstils und am Bauhaus im Bereich der Textilkunst Ansätze zu einer Verschmelzung von angewandter und ‘hoher’ Kunst. Doch nur wenige Künstlerinnen und Künstler, wie beispielsweise Rosemarie Trockel, arbeiten heute mit textilem Material. Glieses Teppiche in Münster und Hagen - keine Wandteppiche, sondern als begehbarer Bodenbelag konzipiert und in der Sparkassenakademie Münster sogar als zweckdienlicher Teppichboden genutzt -, behaupten eine singuläre Position. Gliese hebt bewußt die Trennung zwischen Kunsthandwerk und ‘hoher’ Kunst auf. Er will “Kunst anwenden”.
Gliese folgt damit einer Grundidee des Hagener Museumsgründers Karl Ernst Osthaus (1874-1921), auf den sich der Künstler im Titel seiner Arbeit programmatisch bezieht. Osthaus, der “Kunst und Leben miteinander versöhnen”, Nutzen und Schönheit in Einklang zu bringen suchte, zielte mit der Gründung seines ‘Deutschen Museums für Kunst in Handel und Gewerbe’ (1909) “nach Zeiten tiefster Entfremdung (auf) eine Wiedervereinigung von Kunst und Gewerbe”. Er legte ein Musterlager vorbildlicher Erzeugnisse an, die von den bedeutendsten Künstlern seiner Zeit gestaltet wurden, und zu dessen Beständen auch Teppiche und Bodenbeläge zählten. Er ließ nicht nur sein eigenes Wohnhaus, den ‘Hohenhof’ in Hagen, mit Teppichen Henry van de Veldes ausstatten, sondern veranstaltete ebenso Wechselausstellungen im Hagener Museum Folkwang, in denen sowohl orientalische Teppiche (1909) als auch moderne französische Gobelins (1913) zu sehen waren. An prominenter Stelle, in der Eingangshalle des Museums, präsentierte Osthaus auf flachen Podesten persische Teppiche.
Somit knüpft Carsten Gliese gewissermaßen an die Folkwang-Tradition an, anschaulich auch dadurch, dass nicht nur die Architektur der heutigen KEOM-Halle von 1974 Eingang in das Muster seines Teppichs findet. Glieses ‘Modell Osthaus’ rekurriert ebenso auf den von Henry van de Velde gestalteten Folkwang-Altbau (1902), indem es dessen Grundfarben aufgreift. Das Rostrot der belgischen Fliesen und die Sandfarbe der Wände bilden den Außen- und Innenfond des Bildteppichs, das Graugrün des berühmten Wellenmotivs, das entlang der Treppe aufsteigt, umsäumt das Bordürenmuster.
Das aus den örtlichen Gegebenheiten des KEOM-Alt- und Neubaus abgeleitete, akribisch durchkalkulierte und logisch-konstruierte Konzept der Bildgenese, findet seinen Niederschlag als großflächiges Ornament auf einer horizontal ausgebreiteten Bodenarbeit aus textilem Material. Glieses Teppich-Modell läßt sich unter diesem Aspekt als polychrome Bodenskulptur definieren. Denn eigentlich thematisiert er die genuine Aufgabenstellung der Skulptur: das Volumen - ohne allerdings selbst Volumen zu sein. Das Phänomen Volumen tritt hingegen auf als Leitthema: der Raum wird auf der zweidimensionalen Teppichfläche neu komponiert und eine volumenhaltige Raumvorstellung evoziert. Carsten Glieses ‘Modell Osthaus’ ist somit zugleich auch Skulptur im Sinne einer “Skulptur als Platz”, wie sie Carl Andre definiert hat.
Eine latent mitschwingende, hintergründige Ironie bricht die rationale Dimension von Glieses Modellbau. Die mutwillige ‚Zersprengung‘ des Raumes und seine irritierend-dysfunktional erscheinende Neuordnung bergen ein spielerisches ästhetisches Moment. Der Künstler formuliert ein augenzwinkerndes Aperçu zur vordergründigen Funktionalität und Rationalität der modernen Architektur.
Carsten Gliese verwandelt mit seinem Modellbauverfahren den Museumsraum im Karl Ernst Osthaus Museum somit auf doppelte Weise: erstens, indem er ihn neu komponiert und zweitens, indem er anschließend die Neukomposition wiederum in diesen Museumsraum einbringt. Da das ‘Modell Osthaus’ - ob als Bodenskulptur oder als Bildteppich definiert - so eindeutig Bezug nimmt auf den Museumsraum, kommt die dem Zweckdienlichen enthobene Autonomie des Kunstwerks um so deutlicher zum Vorschein. Die Museumshalle dient dem Künstler als Rohmaterial. Durch seinen inszenatorischen Eingriff beraubt Gliese die Architektur ihrer ursprünglichen Funktion. Der Ausstellungsraum wandelt sich zu einem zweckfreien Kunstwerk. Der Boden des realen Ausstellungsraumes wird quasi zum ‘Sockel’ des künstlerischen Werkes, zum Podest für den Bildteppich. Folglich wird die Museumshalle selbst in ein Objekt ästhetischer Betrachtung und Erkenntnis überführt. Paradoxer Weise tritt jedoch gleichzeitig die Halle wieder in ihre ursprüngliche Funktion ein: nämlich ein Ausstellungsraum zu sein. Dieser bietet jedoch nicht nur Raum für die Reflexion des Kunstwerkes, sondern wird auch durch das in ihm ausgestellte Kunstwerk reflektiert. Glieses ‘Modell Osthaus’ ist ein anschauliches Modell für Wahrnehmungsräume und Raumwahrnehmung, ein bildhaft ausgebreitetes Muster für ästhetische Wahrnehmung im musealen Raum.
Postscriptum
“Die Wirkung des Raumes ist auf die Weise außerordentlich schön geworden und hindert in keiner Weise die Wirkung der ausgestellten Gegenstände.”
Karl Ernst Osthaus, Zur Einrichtung der Museen, 1903
Raumrekurs
Begleittext von Christoph Zitzlaff im Katalog "Eine Höhle für Platon", 2009
Lichtblitze im Souterrain. Ein zunächst kaum dechiffrierbares Bild, das erst komplett irritiert. Das sich, als Dia in mäßig schnellem Intervall stroboskopartig an die Wand geworfen, mehr und mehr in die Wahrnehmung einbrennt, sich schließlich unverlierbar einfräst in das Koordinatensystem von Architektur, Raum und Licht. Was passiert in diesem Verschlag, dieser verwinkelten Kammer unter einem Kellertreppenabsatz der Villa Ingenohl, die Carsten Gliese mit gewohnt subtilen Mitteln in ein Panoptikum der Perzeption verwandelt?
Der Titel von Glieses Arbeit „Sklave“ ist sich selbst Programm. Denn das beständig aufzuckende Lichtbild, von einer auf ein Stativ montierten Fotoblitzlampe produziert, ist eine Aufnahme dieser Projektionsapparatur selbst, als Mehrfachbelichtung in eben diesem Kellerraum von rückwärts fotografiert. Sklave, das heißt, dass diese „Xenolux“-Lampe stets an sich selbst gekettet bleibt, indem sie in nie endender Repetition das Abbild ihrer selbst wieder und wieder projizieren muss – ein sisyphosmäßiger, beständiger Rekurs auf sich und die umgebende Raumsituation im Sekundentakt. Sklave, das ist in Glieses Worten die Sichtbarmachung „der Abhängigkeit einer Lampe von sich selbst.“
Und noch einiges mehr. Denn in dem Eingehen auf die Ortsspezifik führt der in Köln lebende Künstler seine intensive Beschäftigung mit mehrfach gebrochenen und verschachtelten Raum- und Perspektivwahrnehmungen erneut ein Stück weiter. Weil das Dia der „Xenolux“-Lampe auch das Umgebungsbild des Kellerraums zeigt und dieses gewissermaßen auf sich selbst zurückwirft, entsteht ein gedoppeltes Raumkontinuum, eigentlich die Fortsetzung des Verschlages durch eine an der Wahrnehmungslehre geschulte künstliche Lichtintervention, durch die Kreation einer Extremwahrnehmung. Das Resultat ist dieses selbstreflexive, optische Vexierspiel aus Raum und Licht, aus Oberfläche und Tiefenstruktur, ein virtuelles Ausloten sowohl der perspektivischen Möglichkeiten dieser Bonner Raumrealität sowie der intrinsischen Qualitäten von Abbildern überhaupt. „Ich baue mit Licht“, sagt Carsten Gliese. Mit „Sklave“ hat er als moderner Visualarchitekt die vorhandene Raumstruktur der leicht verschimmelten Kammer aus sich selbst herausgeschält und zunächst fragmentiert, um sie dann durch den verwirrend sublimen Stroboskopeffekt neu aufzubauen, der die aus der Aufnahme- und Projektionsprozedur entstehenden Bilder, Schatten und Lichtbalken, der den Vorder-, Hintergrund sowie die Umgebung neu zusammenbindet.
Das Auge der Kamera
Begleittext von Renate Puvogel im Katalog "Carsten Gliese Arbeitslicht", 2009
Das Thema Bildhauerzeichnungen hat eine Jahrhunderte lange Tradition. Dass für einen Bildhauer die Fotografie eine entscheidende Rolle spielt, ist hingegen bis heute nicht gerade üblich. In den 90er Jahren treten die sogenannten Modellbauer wie Thomas Demand, Oliver Boberg oder Lois Renner auf den Plan. Sie überraschen mit Fotografien von Innenräumen, urbanen Situationen oder grotesken Phantasiearchitekturen, denen man nicht ansehen kann, dass ihnen gebastelte oder kunstvoll gebaute Modelle aus Papier, Pappe oder Holz zu Grunde liegen. Selten bekommt der Betrachter diese kleinen, dreidimensionalen Wunderwerke zu Gesicht, vielmehr gilt einzig das Endprodukt, nämlich die rätselhafte wie aufschlussreiche farbige Fotografie als Kunstwerk. Sie ist das bildhafte, teilweise symbolhaltige Resultat aus Beobachtungen, Reflexionen und kritischen Auseinandersetzungen der Künstler mit der Welt.
Im Gegensatz zu den Modellbauern nimmt die Arbeit bei Carsten Gliese ihren Anfang mit dem Fotografieren. Systematisch tastet er mit der Kamera jenes räumliche Areal ab, für das eine Arbeit gedacht ist und in oder an dem sie zu sehen sein wird. Er setzt sich mit Geschichte, Architektur und Funktion eines Raumes auseinander, erfasst seinen Charakter, lenkt sein Augenmerk bzw. die Kamera auf besondere architektonische und installative Eigenheiten wie Simse, Erker und Treppen, Wasser- und Stromleitungen oder Heizungen. Die eingehende Analyse schlägt sich in einer fotografischen Dokumentation nieder und sie liefert das Material für seine konstruktive Interpretation des Raumes. Diese fotografische Neuformulierung ist weniger systematisch als vielmehr subjektiv und von hoher Originalität und sie bietet den sinnlichen Eindrücken wie den geistigen Erkenntnissen neue Nahrung.
Eines der ersten Raumarbeiten Glieses, "o.T." von 1993 (1), eine Installation im Torraum der Kunstakademie, ist wiederholt beschrieben worden, stellt doch die fünfstufige "Sehpyramide" gewissermaßen die Keimzelle für alle weiteren fotogestützten Skulpturen im Raum dar. Beispielhaft kann man anhand dieser pyramidalen Konstruktion erkennen, dass Gliese generell von jenen Bildern ausgeht, welche das Kameraauge aufnimmt. Obgleich die Kamera eigentlich ein rundes Bild empfängt, schneidet die Maske dieses zu einem Rechteck. In jedem Falle handelt es sich bei dem Kamerabild um eine Fläche. Geht man von dieser rechteckigen Fläche aus, so lässt sich von der Kamera zum abgebildeten Objekt eine Pyramide denken, die von der Bildfläche geschnitten wird, es ist die Sehpyramide der Kamera. Die sich von dem einen Kameraauge zum avisierten Objekt verbreiternde Pyramide steht im Gegensatz zu den beiden menschlichen Augen, welche die Objekte nur punktuell erfassen können. Im Unterschied zu dem wandernden Blick der Augen vermag die Kamera einen Teil des räumlichen Neben- und Hintereinanders gleichzeitig zu erfassen und festzuhalten. Möglicherweise resultiert die frappierende Wirkung der in den Raum ragenden plastischen Figur der erwähnten Arbeit, wie sich auf irritierende Weise mehrere Blick- und Bewegungsrichtungen in unauflöslicher Weise zu überlagern scheinen. Als wesentlich in unserem Zusammenhang bleibt die Tatsache, dass die Kamera ein rechteckiges Bild produziert – ein entscheidender Parameter für Glieses fotogestützte Arbeiten: sie basieren alle auf einer Aneinanderreihung von rechtwinklig begrenzten Flächen.
Infolge dieses grundlegenden Charakteristikums weisen nicht nur sämtliche Details der Fotos, sondern auch die dreidimensionalen Modelle und Skulpturen eine minimalistisch konkrete Form auf. Rundungen kommen selten vor. Gliese korrigiert diese grundlegende Maßgabe auch dann nicht, wenn er die Fotos digital bearbeitet. Die klassische, schnörkellose Bau- und Konstruktionsform bestimmt sein Gestaltungsvokabular, für ausschweifende Phantastereien bleibt kein Raum; und dennoch bergen seine Kreationen genügend Momente, die aus dem Rahmen des Realen ausbrechen. Gliese findet und erfindet überraschende und überzeugende Wege, mit denen er visuelle Eingriffe in zu gestaltende Baukörper beschreitet, um das Vertrauen in gewohnte Übereinkünfte zu erschüttern und das Gefühl für Statik und die hierarchische Ordnung von Baukörpern aus den Angeln zu heben. Er entwirft geradezu schwindelerregende Raumkonstruktionen, wenn man sich etwa die Deckenarbeit "Modell Hagen" (2) von 1999 vor Augen führt. Da Gliese existierende Bauteile in seine Gesamtkomposition miteinbezieht, werden einer barocken Deckengestaltung vergleichbar die Übergänge von Zwei- zu Dreidimensionalem fließend.
In den einzelnen Fotos sind durchaus noch charakterisierende Elemente eines Raumes zu erkennen, ja, Gliese schärft sogar den Blick für normalerweise übersehene Bauteile. Doch indem er nachprüfbare Details zusammenfügt, geraten sie zu einem spielerisch entwickelten semiotischen System von Zeichen, Formen und Symbolen. Wie in einem Dominospiel setzt Gliese Foto-Baustein an Foto-Baustein. Das Ergebnis rollt sich zwar dem jeweiligen Raumverlauf entsprechend folgerichtig ab, verwirrt dennoch durch den Wechsel aufnahmebedingter Perspektiven und selbst gewählter Dimensionen. Und es erstaunt, wie Gliese mit den ausschließlich scharfkantigen Architekturzitaten gelegentlich eine nahezu runde, zentrumsbetonte Gesamtkomposition herstellt, wie es ihm mit dem "Modell Osthaus" (3) gelingt. In der unregelmäßig geschnittenen Halle des Karl Ernst Osthaus Museums Hagen sind in seinem farbigen Teppich Rundungen den eckigen Formen wie in einem Kaleidoskop gleichsam eingeschrieben. Es ergeben sich Ornamente und wiederkehrende Muster, ist dies doch sämtlichen Arbeiten gemein, dass der gesamten Komposition ein hoher Grad an Abstraktion zukommt, obgleich doch alles einen gegenständlichen Ursprung hat und auch jederzeit auf ihn zurückzuführen ist.
Wie sehr sich Gliese mit Architektur auseinandersetzt und das Formenvokabular historischer wie zeitgenössischer Architektur verinnerlicht hat, belegen seine "Zwischenbebauungen" (4), fotografische Interventionen an Hausfassaden im urbanen Raum. Auch hier greift Gliese nicht etwa in die vorhandene Substanz ein, sondern fügt einem Baukörper lediglich temporär und additiv eine bis zu haushohe visuelle Fotoapplikation hinzu. Es versteht sich von selbst, dass er für seine Konzepte nicht in sich stimmige Bauten aussucht, sondern solche, die als Einzelbau oder im städtebaulichen Zusammenhang Fehlstellen aufweisen. Mit solchen rein optischen Eingriffen stört er Sehgewohnheiten, und zwar umso mehr, als er im vorgeblendeten Foto Häuserkanten quasi versetzt, Fensterbänder verschiebt oder Treppen collageartig dergestalt stückelt und neu zusammenfügt, dass man letztlich nur noch von der Metapher einer Treppe sprechen kann. Indem er architektonische Details ins Visier nimmt, sie im Foto präzisiert, verdoppelt, vergrößert und mit weiteren kombiniert, kehrt er Merkmale von zuvor eher zufälligen, vernachlässigten oder verdeckten Baugliedern als wesentliche hervor und verschafft einem Bau oder einem ganzen Häuserensemble den Anstrich eines großzügigen Beispiels moderner Architektur. Darüber hinaus leistet Gliese mit seinen visuellen und sogar visionär zu nennenden Angeboten einen bemerkenswerten Beitrag zum Problem der Restaurierung vorhandener Bausubstanz, insbesondere jener der durchschnittlichen Nachkriegsarchitektur. Denn allzu oft artet die Neugestaltung einer Fassade in Dekoration aus und begräbt damit das ursprüngliche Aussehen gänzlich unter einem baufremden Gewand. Gliese untermauert aufs Neue die berechtigte Forderung, dass man das Restaurieren einem fachkundigen Gestalter oder einem Künstler anvertrauen sollte, denn einer wie er entwirft die Neugestaltung aus einer Kombination von Wissen um die Baukonstruktion und unabhängiger Kreativität.
Nicht nur bei den zweidimensionalen Arbeiten im Innen- und Außenraum, sondern auch bei den dreidimensionalen Modellen und Skulpturen gelangen Dokumentarfotos zurück in den architektonischen Raum. Dort verkleiden sie entweder die Oberflächen der einzelnen Skulpturelemente oder sie sind über den Zwischenzustand eines Modells gänzlich umgewandelt in plastische Gestalt. Ganz fern liegt wohl ein Vergleich von Glieses Vorgehensweise mit den Methoden des analytischen und synthetischen Kubismus nicht, allerdings mit dem Unterschied, dass beide Stufen in jedem einzelnen Werk stattfinden. Folgt in den Fotos dem analytischen Schritt der Bestandsaufnahme die Synthese, in welcher er die Details kombiniert, so ergibt sich in den Skulpturen aus dem analytischen Erforschen eines Raumes, dass sich schließlich im Raum vorhandene und vom Künstler entworfene Bauteile quasi durchdringen. In den skulpturalen Arbeiten stoßen drei Realitätsebenen aufeinander, die des Fotos, die des plastischen Körpers und die des beide Komponenten umhüllenden realen Raumes. In den drei Modalitäten konkurrieren auch unterschiedliche Maßstäbe, der Architektur kommt ein anderer Maßstab zu als der Skulptur, während im Foto jeder Maßstab außer Kraft gesetzt ist. Diese Gegensätze spielt Gliese in den Arbeiten auch bewusst voll aus, denn seine Skulpturen schieben sich machtvoll und sperrig in den Raum. Angesichts der minimalistisch anmutende Skulpturen fällt es schwer, ihre wahrnehmbare Gestalt mit ihrer logischen Konstruktion und Funktion in Einklang zu bringen. Zum Vergleich lassen sich die skurrilen Eckskulpturen von Richard Artschwager heranziehen, etwa die Skulptur eines Tisches, der diejenige plastische Gestalt angenommen hat, wie man das Möbelstück von einem einzigen Blickwinkel aus wahrnimmt. Gliese addiert demgegenüber die Ergebnisse mehrerer perspektivischer Sichtachsen zu einer mehrteiligen Skulptur.
Die Methode, einen Innen- oder Außenraum aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufzunehmen, weitet Gliese seit einigen Jahren zu autonomen Fotografien aus, in welchen einzig und allein das Licht ein Raumgefüge so sensibel wie radikal uminterpretiert. Durch mehrfaches, gelegentlich bis zu 100faches Belichten des Filmmaterials, werden Raumpartien überbelichtet, wodurch sie samt ihren Konturen bis zur Unsichtbarkeit verschwinden, so, als seien sie ausradiert. Raumecken sind eliminiert oder aber versetzt, verdoppelt, ja, ganze Raumteile sind hinzugewonnen, und das, ohne der vorhandenen Substanz Gewalt angetan zu haben. Im Unterschied zu Georges Rousse überblendet Gliese nicht einen Raum mit einem ihm fremden Ornament, sondern gewinnt seine verblüffenden optischen Eingriffe ausschließlich aus dem existenten Material. Und wiederum ist es die Kamera, der diese Veränderungen zu verdanken sind, sie erschafft neue Raumzusammenhänge. Schließlich kommt es in dem endgültigen Foto zu einem wundervollen Dialog zwischen den lichten und dunklen Partien; sie sind so austariert gesetzt, dass man das Foto als abstrakte Komposition lesen kann. Die dargestellten Gegenstände und Raumteile kippen zwischen der in die Fläche gezogenen Perspektive, ihrer Raumhaltigkeit und skulpturalen Qualität. Sowohl die überstrahlten als auch die verschatteten Bereiche weisen sehr feine Nuancen in Intensität und Abstufung von Licht und Farbe aus. Solch sensible Graduierung und sinnliche Ästhetik dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass Gliese ausschließlich mit einer analogen Kamera arbeitet. Das gegenüber dem digitalen Pendant aufwändigere Prozedere wird aufgewogen durch die unvergleichliche, eigene Fotoqualität, wie Gliese hervorhebt. So lässt der Künstler auch Störungen im Bild stehen. Neuerdings erscheint die Lichtquelle sogar selbst im Foto. Aufgrund der Belichtungsfolge fasst eine Reihe winziger Lichtpunkten der Lampe das zentrale Fotomotiv wie ein ornamentales Band ein (5). Die Lampe selbst kann zum Lichtobjekt werden, nicht etwa selbstreferentiell, wie man es von Horst Keinings Arbeiten kennt, oder gar didaktisch, vielmehr wandelt sich das Arbeitslicht zum wundervollen Bildmotiv. Und hier erschafft Gliese nun doch einmal ein rundes Objekt: es ist das Abbild der sich blütenartig entfaltenden, leuchtenden Lampe, die sich um sich selbst zu drehen scheint (6).
James Turrell hat mit künstlichen Lichtquellen wie auch mit der Sonne selbst seine bekannten Farbräume und auch räumliche Lichtecken geschaffen; will man aber überhaupt Vergleiche anstellen, dann scheinen mir am ehesten die Konstruktivisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem experimentierfreudigen Künstler verwandt zu sein, und in diesem Zusammenhang ganz besonders László Moholy Nagy. Der Ungar hat bekanntlich ein bahnbrechendes interdisziplinäres Werk geschaffen, indem er in seinen Arbeiten eine bewegte und bewegende Zwiesprache zwischen Objekt, Licht und Raum hervorruft. Selbst seine lichtgespeisten Fotos sind von dieser ruhigen inneren Bewegtheit erfüllt. Es geht hier nicht um das Formenvokabular im Einzelnen, vielmehr ist der freie, experimentelle, zugleich konzeptuelle Umgang mit solchen Stoffen und Disziplinen, zwischen denen auch Carsten Gliese hin und her manövriert, vergleichbar.