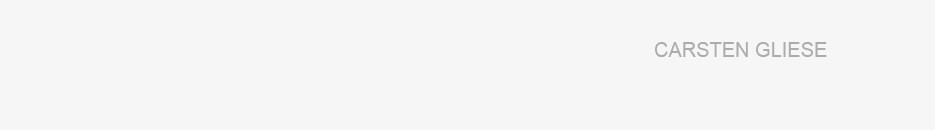Begleittext von Ernest W. Uthemann im Katalog "Carsten Gliese, Arbeitslicht", 2009
Seit der Erfindung der Fotografie, erst recht seit der Erfindung der von ihr abgeleiteten Techniken des Films und des Fernsehens, musste die Geschichte des Blicks auf die Welt neu geschrieben werden. Waren zuvor die in den Köpfen der Menschen gespeicherten Bilder der Welt zwar erheblich weniger zahlreich gewesen, so verdankte sich der mit Abstand überwiegende Teil dieses Archivs aber der jeweils eigenen Anschauung. Das änderte sich nun: Seit dem Beginn der massenhaften Bildproduktion ist der Anteil der „selbstgesehenen", der nicht medial vermittelten Bilder in den entsprechenden Speichern des Hirns rapide gesunken. Unserem Gedächtnis stehen zwar unverhältnismäßig mehr Bilder der Welt zu Gebote als unseren Vorfahren, aber immer weniger davon verdanken wir dem eigenen, unvermittelten Schauen. Einschneidender noch wirkten die Veränderungen der Betrachterperspektive. Die Augenzeugen eines Ereignisses haben – ebenso wie die Betrachter jedes Gegenstands – einen individuellen, gelegentlich nur unwesentlich durch Standort und Körpergröße differierenden Blickwinkel. In einem Amphitheater oder auf dem Marktplatz gewinnt jeder Anwesende einen eigenen, wenn auch oft nur geringfügig von anderen abweichenden Anblick. Selbst auf die „Guckkastenbühne" schauen Hunderte von Augenpaaren aus verschiedenen Richtungen. Ein fotografierter Gegenstand jedoch, ein fotografiertes Geschehnis ist für immer aus einem einzigen Blickwinkel festgehalten; jeder Betrachter einer Fotografie ist gezwungen, die Perspektive der Kamera einzunehmen.
Man mag einwenden, dies gelte auch für die Malerei. Dieser aber fehlt das Vertrauen in die Authentizität des Dargestellten, der Bonus, den die Fotografie genießt: dass sich die Welt gewissermaßen selbst abbildet, dass der Betrachter Zeuge eines Moments wird, der genau so einmal stattgefunden und ausgesehen hat. Das heißt: Dem Gemälde wird in jedem Fall zugestanden, die individuelle Perspektive eines Einzelnen (des Malers) zu repräsentieren; der Objektivitätsanspruch, der der Fotografie entgegengebracht wird, überlagert noch immer häufig die Erkenntnis, dass auch hier ein separater Blickwinkel das Dargestellte bestimmt.
Eine Fotografie ist, nüchtern betrachtet, nichts weiter als ein flächiges Muster aus Partien verschiedener Helligkeit. Gewiss ähneln diese Konstellationen der Erscheinung der Welt, wie wir sie mit eigenen Augen wahrzunehmen scheinen. Doch muss man bedenken, dass die Fotografie im 19. Jahrhundert in Europa erfunden wurde, dessen Kunst von einer seit der Renaissance ständig verfeinerten Tradition naturalistischer Darstellung geprägt war, einer Darstellung auch, die illusionistische Perspektiven aus Linien und Flächen konstruierte. Einwohner von Feuerland, so haben Anthropologen festgestellt, konnten Tiere ihrer eigenen Umwelt auf Fotografien nicht erkennen – die Bilder entsprachen nicht ihrer hergebrachten Darstellungsweise dieser Lebewesen. Wer weiß, ob unsere eigenen Vorfahren im mittelalterlichen Europa auf Fotos mehr erkannt hätten als ein abstraktes Pattern, ein Chiaroscuro ohne gegenständliche Verweise. Als solches nutzt Carsten Gliese Fotografien. Er „zerlegt" etwa Interieur-Fotos und separiert dabei Flächen entlang der Grenzen zwischen helleren und dunkleren Partien, dabei teilweise auch ohne Rücksicht auf eine Unterscheidung von Figur und Grund.
Nur unsere visuelle Erfahrung mit Fotografien (und mit dem Vergleich zwischen Fotos und unserer Wahrnehmung der Dinge) erlaubt uns, beim Betrachten einer Fotografie Schlüsse über die Beschaffenheit des Dargestellten zu ziehen, vor allem über ihr Volumen. Wirklich sicher können wir uns aber nicht sein: Wir sehen nur bestimmte Flächen, die wir im Kopf zu Konstellationen von Volumen und Leerräumen ergänzen. Mit dieser Uneindeutigkeit spielt Gliese. Er unterstellt etwa, dass die Fläche, die in einem Foto als Raum unter einem Tisch wahrgenommen wird, mit ebensolcher Berechtigung als Körper gesehen werden könnte. Also verleiht er dieser Binnenform ein Volumen und fügt dieses mit anderen in die Dreidimensionalität überführten Partien des Fotos zu einer Skulptur, ohne dabei aber den ursprünglichen Zusammenhang zu berücksichtigen. Es entstehen plastische Körper, die zwar hier und dort noch Reste der ursprünglichen Abbildlichkeit enthalten (ein Tischbein durchschneidet als Rinne eine trapezoide Form, die Lehne eines Sessels bleibt als perspektivisch verzerrter Schatten erahnbar), doch im Ergebnis sehen wir eine Skulptur, die einem konstruktivistischen Regelwerk verpflichtet scheint. Und so ist es ja letztlich auch: Die Abstraktion, welche die Fotografie von der Welt vorführt, treibt Gliese auf die Spitze. Wir werden gewahr, dass uns ein fotografisches Bild keine eindeutigen Ansichten der Welt liefert, sondern lediglich Vorschläge zur Deutung macht.
Mit der Frage „Wie geht es hinter dem für uns Sichtbaren weiter?" beschäftigt sich Carsten Gliese auch in dem Entwurf für eine Wandgestaltung an der Brandmauer des Gebäudes der Stadtgalerie in der Katholisch-Kirch-Straße, die die Stadt Saarbrücken in Auftrag gab. Wie Scheiben eines geschnittenen Toastbrots reihen sich Segmente nebeneinander (oder scheinbar hintereinander), die in ihrer Form bei näherer Betrachtung von bestimmten Partien der Fassade des Gebäudes abgeleitet sind: den Fensteröffnungen, den Pilastern, dem Giebel, vorkragenden und zurückspringenden Elementen. Gliese hat das Haus „zerschnitten" und dabei die Entdeckung gemacht, dass die offenbar so selbstverständliche Annahme, hinter einer Fassade befänden sich Räume, eigentlich nicht gerechtfertigt ist: Ein Gebäude könnte auch ein kompakter Körper mit einer ganz anderen als der erwarteten inneren Struktur sein.
Das Bild, das wir uns von der Welt machen, ist natürlich von unseren Erfahrungen gestützt, doch das bedeutet nicht zwingend, dass diese beliebig und unreflektiert auf neue Situationen anwendbar sind. Wenn wir unseren je eigenen Blickwinkel für ausreichend halten, die Phänomene der Welt zu erkennen, werden wir uns immer wieder täuschen. Auch unsere individuellen Erfahrungen reichen nicht aus, die Dinge um uns zu deuten, denn dann klopfen wir immer nur Neues auf Ähnlichkeit mit einem höchst beschränkten Fundus an Gewusstem ab. Ähnlichkeit aber ist das entscheidende Merkmal der Fälschung, der Täuschung also. Carsten Gliese ist kein Fälscher, er bietet uns zur Schärfung unserer Sinne und unseres Denkens Alternativen der Wahrnehmung an.
So auch in seiner Arbeit „5 Nischen", die für einen Raum in der Stadtgalerie entworfen wurde. In die sechseckigen, mit Platten verschlossenen und zum Teil mit zusätzlich hinein gebauten Ecken versehenen Fensternischen eines der Ausstellungsräume im 2. Obergeschoss hat der Künstler auf Vliespapier gedruckte Fotos von Karton-Architekturen geklebt, von skulpturalen Objekten, deren Originalgröße deutlich wird, wenn man erkennt, dass die „Fliesen", auf denen sie zu stehen scheinen, in Wirklichkeit die Quadrierungen Zentimetereinteilung einer Schneideunterlage sind. Die Oberfläche der fotografierten Elemente ist mit waagerechten Kanneluren gegliedert, die ein wenig an die Reliefierungen des Art Déco erinnern. Diese horizontalen Linien sollen dem Blick des Betrachters Anschlüsse und Versprünge auf dem vor- und zurückspringenden Grund simulieren; im Vorbeigehen, das heißt: beim Wechsel des Blickwinkels zeigt sich aber, dass das, was man etwa soeben noch für eine geschlossene Mauer gehalten hat, sich mit einer weißen Zäsur zu einem freistehenden Pfeiler wandelt, dessen Raumrichtung sich gegenüber dem voraufgegangenen Eindruck auch verändert hat. Es wäre nicht richtig zu meinen, nichts sei hier so, wie es scheint – es ist alles genau so, wie es scheint, wie es sich aber aus verschiedenen Perspektiven darstellt.
Gliese schafft zweifellos trompe-l’œils, die aber die Sinne nicht verwirren, sondern klären sollen, keine illusionistischen Augentäuscher, die nur funktionieren, so lange sie den Betrachter darüber im Unklaren lassen, wie sie gemacht sind. Glieses Arbeiten sind von einer nüchternen Offenheit, sie lassen uns nicht daran zweifeln, was wir sehen. Im Gegenteil: Diese Arbeiten animieren den Betrachter zur Freude am Perspektivwechsel, zu der Lust an der Erkenntnis, dass die Welt viel interessanter wird, wenn man sich auf die Uneindeutigkeit der Phänomene und ihrer Bilder einlässt.
Klärende Täuschungen