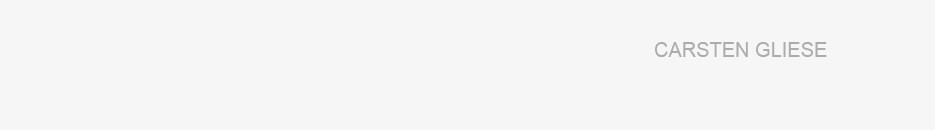Begleittext von Günther Kebeck im Katalog "Eine Höhle für Platon", 2009
Eines der eindrucksvollsten Beispiele illusionistischer Malerei ist das Deckenfresko „Die Apotheose des heiligen Ignatius“ von Andrea Pozzo im Mittelschiff der barocken Kirche San Ignazio in Rom, entstanden 1691-94. Das flache Tonnengewölbe erscheint dem Betrachter durch die Malerei als ein kontinuierlicher Raum von außerordentlicher Tiefe. Der Perspektivetheorie Leon Battista Albertis folgend wird über den Zentrumstrahl der Sehpyramide („il principe“) eine Verbindung des Betrachters zur Unendlichkeit hergestellt. Damit dieses Werk sein illusionistisches Potential entwickeln kann, muss dem Besucher eine Beobachterposition vorgeschrieben werden. Diese liegt im Mittelpunkt der Projektion und ist durch eine kreisförmige Messingplatte auf dem Boden markiert. Nur, wenn der Betrachter stationär bleibt, und - streng genommen - nur, wenn er das Bild monokular betrachtet, ist diese Illusion perfekt. Bewegt er sich aus dem Projektionszentrum, beginnen zunächst die Architekturelemente und später auch die figürlichen Darstellungen zu „stürzen“. Deformationen erscheinen und schließlich wirkt das Gemälde flach, das Dargestellte ist kaum mehr zu erkennen. Für diese besondere Situation gilt Glaukons Erwiderung, nachdem Sokrates ihn in Platons Höhlengleichnis eingeführt hat: „Ein gar wunderliches Bild … und wunderliche Gefangene“. Carsten Gliese bedient sich bei seiner Installation Paravent als Fotograf ebenfalls der Zentralperspektive, geht dabei aber dezidiert einen anderen Weg.
Zunächst zur Entstehung der Arbeit: Ausgangspunkt ist die Architektur des mit 556 x 550 cm nahezu quadratischen Ausstellungsraums (Höhe 378 cm). Ausgehend von den Proportionen der Wände bzw. der Lage und Maße signifikanter Raumelemente, wie Tür, Fenster und Eckvorsprung, werden zwei 19,4 cm hohe Modelle aus geschichteter Pappe gefertigt. Diese bestehen aus einzelnen Wandkörpern in unterschiedlicher Ausrichtung. Die Modelle sind eigenständige Objekte, die erneut fotografiert werden. So wird das Modell wieder zum Bild. Schließlich werden diese Bilder - stark vergrößert - auf Vlies gedruckt und auf den Wänden der Paravents flächig verklebt (Länge ca. 5 laufende Meter, Höhe 305 cm). Der Paravent ist damit Skulptur und Bild zugleich.
„Paravent“ bezeichnet allgemein eine zusammenlegbare und transportable Wand, die der Unterteilung oder dem Sichtschutz dient. Er besteht aus einzelnen Elementen, die beweglich miteinander verbunden sind. Dadurch, dass der Winkel zwischen den Stellflächen fast frei veränderbar ist, kann die Krümmung des Paravents variabel gewählt werden. Je nach Ausstattung und Alter gelten sie als kostbar, aber auch als instabil. Ihre praktische Aufgabe ist es, für den eintretenden Betrachter Teile eines Raumes zu verdecken oder im Raum befindliche Personen oder Gegenstände zu verbergen. Die Installation von Gliese weist wichtige Unterschiede zum traditionellen Paravent auf, die für das Verständnis der Arbeit bedeutsam sind. Der erste betrifft die Stabilität. Aus einer seitlichen Position erkennt der Betrachter die 7 cm starke Konstruktion. Diese Paravents sind keine Kulissen, es sind veritable Wände. Die Installation ist eine temporäre Architektur mit eigener Stabilität, eigenem Gewicht und eigenem Volumen. Die Paravents haben einen Abstand zur Wand und erreichen nicht die Höhe der Decke. Sie stellen daher einen Eingriff in den bestehenden Raum dar, dessen Grenzen und Besonderheiten (z.B. Wasseranschlüsse und Kacheln) sichtbar bleiben. Der zweite Unterschied bezieht sich auf ihre Variabilität. Zwar finden sich mannigfache Winkel, aber jeder Paravent besteht letztlich aus nur einem starren Element mit fester Krümmung. Zu den beabsichtigten Irritationen zählt, dass der Betrachter im rechtwinkeligen Ausstellungsraum - und für Architektur allgemein - auch für diese Krümmungen rechte Winkel erwartet, die Paravents aber vorwiegend stumpfe und spitze Winkel zeigen. Als dritten Aspekt sei auf die fehlende Verdeckung verwiesen. Die Paravents von Gliese sind keine Raumteiler. Der Betrachter kann nicht hinter sie treten. Hier wird nichts vor seinem Blick verborgen. Eher machen sie etwas neu sichtbar: den Ausstellungsraum.
Während die barocke Illusionsmalerei den stationären Betrachter voraussetzt und seine Entscheidung zur Bewegung die Illusion zerstört, fordert die Installation von Carsten Gliese einen „selbst bestimmten Betrachter“. Nur ihm erschließt sich die ästhetische Qualität der Installation. Hier gibt es keinen „idealen“ Beobachterstandpunkt oder einen ausgezeichneten Ort. Erst mit der Bewegung im Raum, im Wechsel der Richtungen und der Variation des Abstands wird die Arbeit der Anschauung zugänglich. Zwei Beispiele: Auf den Paravents finden sich Elemente von Multistabilität. Gemeint ist, dass sich beim Entlanggehen einzelne Elemente (zum Beispiel Mauervorsprünge) anschaulich aus dem Bild herauszulösen scheinen und zu eigenständigen visuellen Objekten werden. Bei der Bewegung unterliegen sie nun der Formkonstanz. Bei Veränderung des Betrachtungswinkels wird nicht ein neues Objekt gesehen, sondern seine Rotation Ein zweites Beispiel: Illusionistische Kunst muss zwangsläufig ihre Materialität leugnen. Nähert sich der Betrachter einer Bildoberfläche wird es jedoch praktisch unmöglich ihn zu täuschen. Die Arbeit von Gliese fordert beide Sehweisen und ihren Vergleich. Zunächst nutzt Gliese optimal die Möglichkeiten illusionistischer Fotografie. Die auf den Paravents gezeigte Architektur ist klar gegliedert. Grundelemente wie Wand, Pfeiler, Gesims und Öffnung treten deutlich hervor. Andererseits führt die horizontale Wiederholung der Elemente über die Krümmung hinweg zu fortlaufenden Linien und zu einem Zusammenschluss. Jeder Paravent wird als ein Objekt gesehen. Dies ist die entscheidende Voraussetzung, um über die Simulation einer einheitlichen und natürlichen Lichtführung die Illusion von Architektur zu erzeugen. Gleichzeitig gestattet Gliese dem Betrachter durch die starke Vergrößerung einen Blick auf Textur und Material des ursprünglichen Modells. Damit bleibt auch der Arbeitsprozess sichtbar. Es entsteht entweder eine Irritation oder ein Zugleich, die Illusion ist gefährdet.
Beim Betreten des Ausstellungsraums hat der Betrachter zunächst den Eindruck von Ordnung und Übersichtlichkeit. Beim längeren Verweilen und durch den Wechsel der Standpunkte und Blickrichtungen wird die Komplexität der Installation deutlich. Sie überfordert die menschliche Wahrnehmung. Der Betrachter ist nicht in der Lage die Teile zu einem schlüssigen Bild zusammenzufügen. Diese Fragmentierung ist Programm. An die Stelle der Illusion tritt die Imagination. Der Betrachter ist aufgefordert, die Bruchstücke in seiner Vorstellung zu ergänzen, aber nicht in der Art eines Puzzles sondern zu einem neuen Raum. Einem Raum, der so nur in seiner Vorstellung existieren kann. Die Installation Paravent schafft hierfür einen denkbar günstigen Ausgangspunkt, weil sie mit äußerster handwerklicher und formaler Präzision gearbeitet ist. Sie präsentiert ein Objekt von hoher ästhetischer Qualität, das verschiedene Erfahrungen des Zugleich ermöglicht.
Jenseits der Illusion